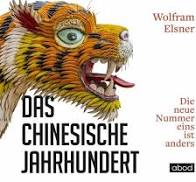Den kapitalistischen Tiger reiten
Mit einer Überfülle an Fakten tritt Wolfram Elsner dem im Westen verbreiteten Chinabild entgegen
Von Irmtraud Gutschke
Ein Professor für Volkswirtschaftslehre aus Bremen bekommt einen Lehrauftrag an der School of Economics in Changchun, im Nordosten von China. Regelmäßig ist er nun dorthin unterwegs, kann nicht nur Flugplätze und Bahnhöfe vergleichen, sondern überhaupt deutsche Medienberichte mit der Wirklichkeit vor Ort. Dabei war das Interesse für die Volksrepublik bei ihm schon früher erwacht. In seiner Studentenzeit hatte er wie andere auch die „Mao-Bibel“ gelesen und von fern die „Kulturrevolution“ beobachtet. Später rief das „Massaker“ 1989 auf dem Tiananmen-Platz nach Analyse vor dem Hintergrund geopolitischer Auseinandersetzungen. Im Freiheitswillen, Ideologie zu durchschauen und sich nicht für dumm verkaufen zu lassen, kann sich der Autor dieses Buches von Gleichgesinnten umgeben wissen. Wie aber kommt man gegen Vorurteile an, die sich in vielen Köpfen verwurzelt haben? Fakten, Fakten, Fakten – eine Überfülle steckt im Buch. Das Werk eines Wissenschaftlers, gleichwohl mit heißem Herzen geschrieben, im fremden Land immer das eigene im Blick: Wie wird es in Deutschland, in Europa weitergehen?
Hier aufgeregtes Rudern in einer Wirtschaftskrise, die sich durch Corona noch verstärkt, dort eine auf lange Sicht hin geplante Entwicklung unter Führung der KPCh, einer kommunistischen Partei, die das Ruder fester denn je in der Hand hält, was Antikommunisten natürlich gar nicht erfreut. Auch wer immer noch einen Funken des sozialistischen Traums in der Seele hat, hält das Land womöglich für abtrünnig. Kapitalismus in Reinkultur? Vieles, was ich über China zu wissen glaubte, das merkte ich beim Lesen, stammt aus früheren Jahrzehnten, aus dem vorigen Jahrhundert gar. Milliardäre und Wanderarbeiter, Billigproduktion für den Westen, Umweltsünden – ich hatte ein Entwicklungsland vor Augen, wie es China längst nicht mehr ist. Kein Abnehmer mehr für unseren Müll und immer weniger eine verlängerte Werkbank, die uns billig kommt. Nicht „uns“ natürlich, sondern den Profiteuren der Wirtschaft. Wobei die „kleinen Leute“ auch günstig einkaufen wollen und sich gleichzeitig fürchten, die heimische Produktion könnte ins Hintertreffen geraten, wenn vieles „Made in China“ ist.
China repräsentiert heute knapp 20 Prozent des Weltsozialprodukts und hat die USA (15 Prozent) bereits überholt. Mit Corona könnte sich diese Relation noch ändern. Interessant das Kapitel zur Epidemie, das der Autor noch ins Buch eingefügt hat. „Wäre sie in einem anderen Land ausgebrochen, das … nicht die enormen Organisations- und Handlungskapazitäten Chinas und diese erstaunliche sozialpsychologischen Stabilität hat, hätte dieses Land in ein existenzielles Chaos, Paniken und Revolten eingeschlossen, bis zum völligen Kollaps hineinschliddern können.“
Während der Kapitalismus immer mehr zu einer „Umverteilungsmaschine nach oben“ degeneriert, haben Unternehmer in China die „Dominanz der Politik und der nationalen Entwicklungsziele zu respektieren“. Kurz gesagt: Der private Sektor ist dafür da, dem Land zu dienen, nicht umgekehrt. Wie diese Art von Produktionsverhältnissen gleichzeitig einer enormen Produktivkraftentwicklung zugutekommt, dürfte gerade diejenigen nachdenklich machen, die das Scheitern des sozialistischen Versuchs in der DDR erlebt haben. Dass man es in China studiert hat, davon kann man ausgehen. Da fällt mir vieles ein, was ich den Autor fragen möchte. Wie vertragen sich Regulierung und Experimentierfreude? Wie ist der Balanceakt zu meistern zwischen dem Streben nach politischer Stabilität und der Stärkung von Arbeiterrechten, wenn die KPCh partiell sogar Protestaktionen unterstützt? Vor allem: Wie kann verhindert werden, dass Macht degeneriert?
Eine stabile, kaufkräftige Binnenökonomie (auch wenn die Löhne gemessen an unsrigen zum Teil noch viel niedriger sind), riesige Humanressourcen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Ingenieur- und Naturwissenschaften („4,7 Millionen Absolventen in diesen Fächern stehen zum Beispiel knapp 600 000 in den USA gegenüber) und eine hocheffektive, staatlich koordinierte Industrie- und Finanzpolitik haben dazu geführt, das US-Sanktionen das Land nicht schwächen konnten, im Gegenteil. Wolfram Elsner zitiert Xi Jinping: „Chinas Sicherheit ist die soziale Sicherheit der Arbeiterklasse.“
Klare, kraftvolle Sprache, authentisch, echt. Lesend spüre ich das Defizit, selbst noch nie in China gewesen zu sein. Leser können dem Autor glauben – oder auch nicht. Keinem der in hiesigen Medien verbreiteten Vorwürfe gegen China weicht er aus: Tibet, Taiwan, die Lage der Uiguren in Xinjiang, Hongkong, Umweltverschmutzung, Ai Weiwei, Strafrecht, soziale Medien … Nach einer Periode der De-Regulierung ab 1978 gibt es seit 2007 einen verschärften Kampf gegen Korruption, unterstützt durch eine verbreitete „Ungleichheitsaversion in der Bevölkerung“. Zugleich ist China insbesondere durch das Projekt Neue Seidenstraße, das 137 Länder umfasst, Treiber für Wachstum im globalen Süden und hat zwischen 2015 und 2018 ca. 380 Milliarden Dollar in Europa investiert. Laut Wolfram Elsner ein Innovationsexporteur, von dem Deutschland nur profitieren kann. „China könnte zusammen mit Russland und anderen Seidenstraßen-Ländern vermutlich auch ohne uns, wir aber könnten vermutlich nicht ohne China.“
Was ist das für ein System, das sich „Diktatur des Volkes“ nennt? Schönes Zitat: „China wird nicht vom kapitalistischen Tiger geritten, es reitet den kapitalistischen Tiger.“ Der Autor erklärt viel und sieht das Land auf dem Weg zu einem Sozialismus, den wir noch nicht kennen. Dabei wird immer wieder etwas ausprobiert und korrigiert. Wenn einem eigene Anschauung fehlt, ist ein Gefühl von Fremdheit normal, zumal China mit der bis heute lebendigen konfuzianischen Tradition eine viel längere und andere Geschichte als Deutschland hat. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, ob mir das Sozialpunktesystem gefällt, das Madeleine Genzsch im Anhang (leider nur auf der Webseite des Verlages verfügbar) beschreibt. Einer solchen Erziehung und sei es zum Besten, möchte ich mich als Erwachsene nicht unterwerfen müssen. Aber ich verstehe, dass aggressiver Egoismus, wie er mit der schnellen Bereicherung einzelner einhergehen kann, auch eine Gefahr für ein Gemeinwesen bedeutet, das sich als gerecht versteht. Wie überhaupt vieles der Abwehr von Gefahren dient.
Wolfram Elsner legt Wert darauf zu betonen, dass China keinen Modellexport betreibt, dass es vielmehr „überraschend stabil“ seinen eigenen Weg geht „zu technologischer Innovation, Einkommens- und Wohlfahrtswachstum, radikalem Umwelt- und Klimaschutz, wachsender internationaler Vernetzung – und zu erheblicher marktwirtschaftlicher Dynamik unter starken Formen staatlicher Planung, eigentumsrechtlicher Vielfalt, Sharing-Ökonomie und sozialer Mobilisierung“. Aber steht im internationalen Wirken Chinas nicht doch das nationale Interesse höher als das anderer Länder? Andererseits, wenn man in der Welt nach uneigennützigem, solidarischen Handeln sucht, wird man bei China eher noch fündig werden als in unseren Breiten – und schon gar nicht bei „America First“.
Der Buchtitel „Das chinesische Jahrhundert. Die neue Nummer eins ist anders“ verweist auf den Konflikt: Ein „Platzhirsch“ wehrt sich gegen den Neuankömmling. Mit seinem China-Verständnis steht Wolfram Elsner auf dem Buchmarkt nicht allein. Wer es nicht teilen will, findet Angstmache noch und noch. Gerade erst erschienen: „Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet“ von Mareike Ohlberg, die beim German Marshall Fund arbeitet. Der Meinungskampf um China verwundert nicht. Die neue „Nummer eins“ scheint die Welt in der Tat zu verändern. Aber muss das Konkurrenzprinzip, das unsereinem in Fleisch und Blut übergegangen ist, für alle Zeiten zwingend sein?
Da ergibt sich ein Bezug zum Konzept „Tianxia“, das auf die Zhou-Dynastie vor 3000 Jahren zurückgeht und dem der chinesische Philosoph Zhao Tingyang unlängst ein Buch widmete: „Alles unter dem Himmel“. Was mich an den „Herrn des blauen Himmels“ erinnert, der alle alten Nomadenvölker vereint: Tengri, jeweils nur verschieden ausgesprochen. Zwischen ihm und Yer, der Mutter Erde, befindet sich der Mensch, der noch keine Staaten und keine trennenden Religionen kennt. Tengri kann man im Werk des kirgisischen Schriftstellers Tschingis Aitmatow und bei dem Mongolen Galsan Tschinag begegnen. Und lebt er nicht auch hier im erwachenden Umweltbewusstsein? Es ist eine Macht die alles verbindet und vom Menschen nur eines verlangt: Respekt, Balance, Harmonie. Niemand ist ausgeschlossen, so wie die Mutter Erde die ganze Menschheit trägt und überhaupt alles Leben. Diese Vorstellung habe ich lange schon so utopisch wie zeitgemäß gefunden.
Wolfram Elsner zitiert Xi Jinping: „Wir wollen kein luxuriöses, verschwenderisches Leben. Wir wollen ein gutes Leben für alle.“ .Dass dies die Quadraturen aller möglichen Kreise einschließt und sowieso in China noch mehr ein „Wollen“ ist als heutige Realität, vermindert nicht die Strahlkraft einer Utopie, die viele Menschen auf der Welt im Herzen tragen.
Wolfram Elsner: Das chinesische Jahrhundert. Die neue Nummer eins ist anders. Westend Verlag. 384 S., br., 24 €.