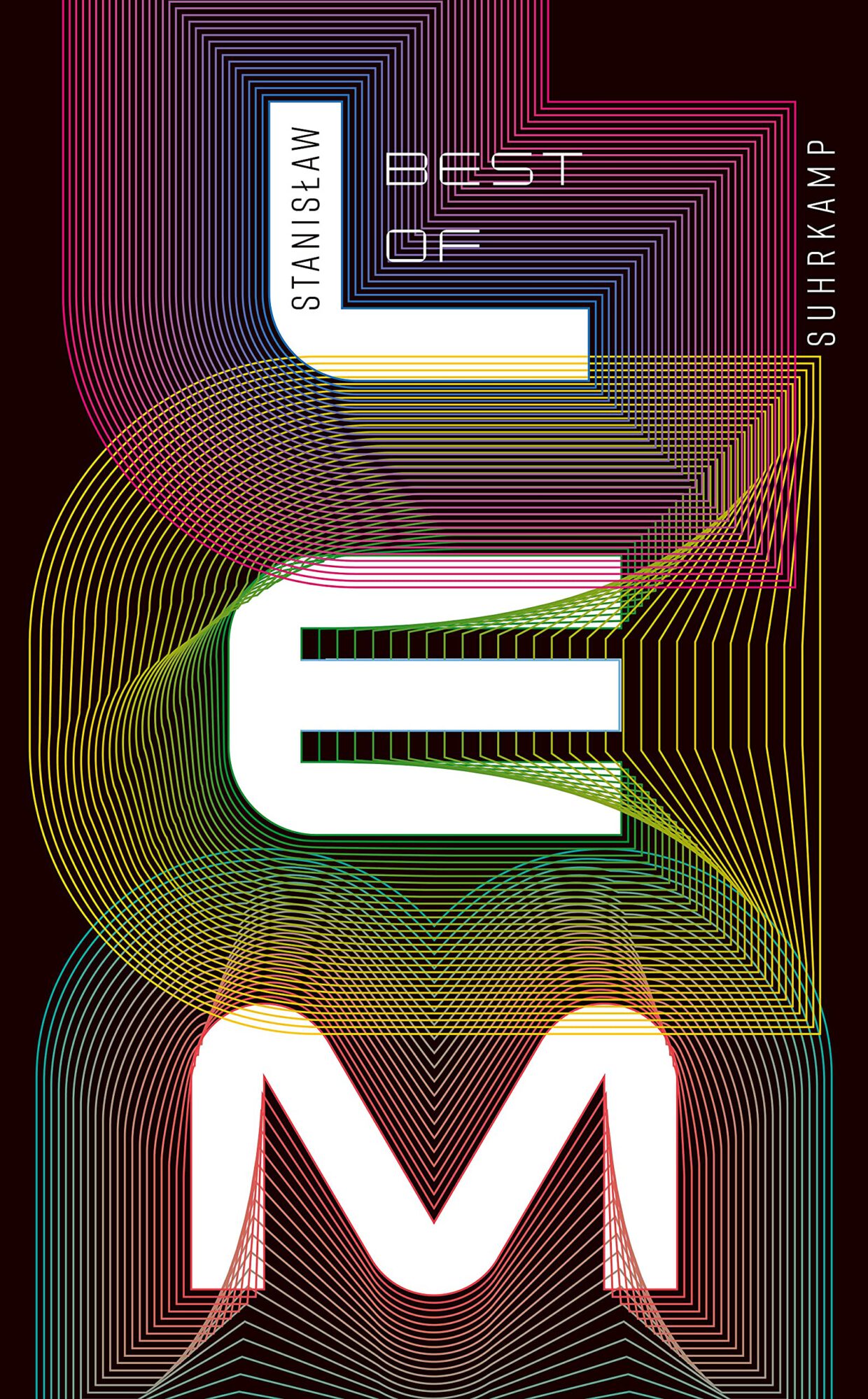In der „Technologiefalle“
Nicht nur ein Meister spannender Science Fiction: Vor 100 Jahren wurde Stanislaw Lem geboren
Von Irmtraud Gutschke
Ein Träumer war er wohl und ließ doch keine Hirngespinste gelten. Er liebte die Spiel der Fantasie ebenso wie wissenschaftlich nüchternes Denken. Eine hohe Meinung hatte er von sich und sparte nicht mit Selbstironie. Stanisław Lem, am 12. September 1921 in Lemberg geboren, wurde weltberühmt als Meister der Science Fiction und war doch mehr als das: ein Philosoph und scharfsinniger Visionär, beschlagen in vielen Wissensgebieten, der immer mehr zum Zweifler und Warner wurde.
„Ich bin ein Dilettant, der wie ein neugieriger Floh von einem Gebiet auf das andere hinüberspringt“, sagte er im Gespräch mit dem polnischen Literaturkritiker Stanisław Bereś, das aus seinem Band „Lem über Lem“ (1984) in die Sammlung „Best of Lem“ übernommen wurde, den Jan-Erik Strasser jetzt bei Suhrkamp herausgab. „Dabei habe ich festgestellt, daß ich in der ganzen weltweiten Palette der Fantasy-Autoren eine Ausnahme bin. Denn bei all diesen Golems und Kosmogonien bin ich doch zugleich ein unverbesserlicher Skeptiker, der an alle diese Bermudadreiecke, fliegenden Untertassen, an Gedankenlesen, Psychokinese, das Seelenleben der Pflanzen und Tausende andere Dinge, von denen diese Literatur lebt, nicht glaubt.“
Einwenden könnte man, dass es ja der Reiz von Science Fiction ist, in fremde Welten mitgenommen zu werden und dass Lem dieses Leserbedürfnis wohl zu bedienen wusste. Immer noch ist mir „Der Planet des Todes“ aus dem Bücherschrank meines Vaters in Erinnerung (die DDR-Ausgabe des Romans „Die Astronauten“ von 1954 erschien wie fast alles von Lem im Verlag Volk und Welt). Da wird im Tunguska-Krater in Sibirien, der 1908 tatsächlich durch eine Detonation entstand, eine Kapsel gefunden, die offenbar von der Venus stammt. Wie ein Raumschiff dorthin geschickt wird, die Besatzung auf rätselhafte Phänomene trifft, in Gefahr gerät und schließlich eine schreckliche Entdeckung macht, habe ich damals atemlos gelesen. Dass im Jahre 2003 auf Erden eine kommunistisch geeinte Weltgemeinschaft besteht, nahm ich hin. Und die Angst, dass sich – wie auf der Venus – eine ganze Zivilisation auslöschen könnte, war nach Hiroshima und Nagasaki gegenwärtig.
Stanisław Lem hat später mehrfach betont, dass er kein Kommunist sei. Den Kollaps des stalinistisch konzipierten sozialistischen Versuchs im sowjetischen Imperium hat er vorausgesehen. Aber an der Notwendigkeit einer Weltgemeinschaft auf einer neuen gesellschaftlichen Grundlage zweifelte er nie, was die Weltraumforschung betrifft ebenso wie die Probleme auf Erden, allen voran die Klimarettung. Durch all seine Texte bis zuletzt zieht sich der menschheitliche Gedanke und die Bitterkeit darüber, dass Einzelinteressen einer notwendigen Gemeinschaftlichkeit entgegenstehen. Schließlich mag diese Bitterkeit mit zu der Entscheidung geführt haben, keine Belletristik mehr zu schreiben, urteilt Alfred Gall in seiner Lem-Biographie, in der er auf beeindruckende Weise das Schaffen des Schriftstellers mit den historischen Hintergründen verbindet, von denen dieser sich immer wieder zu emanzipieren suchte.
Freiheitswillen und Vorsicht: Seine jüdische Herkunft habe Lem „sehr diskret behandelt“, so Gall. Im September 1939 überschritt die Rote Armee die polnische Ostgrenze, fast zeitgleich griffen deutsche Truppen Lemberg an. Im Juni 1941 wurde die Stadt eingenommen. „Die meisten Verwandten der Familie Lem wurden in der Zeit der deutschen Besatzung getötet.“ Was er als Jugendlicher erlebt hatte, konnte nicht ohne Spuren bleiben, und auch nach der Umsiedlung der Familie nach Krakau – wo er am 27. März 2006 starb – traf er immer wieder auf antijüdische Stimmungen. Irgendwie musste er sich einrichten, und er wollte seine Möglichkeiten als weltweit anerkannter Schriftsteller (Übersetzungen in 57 Sprachen) nicht gefährden, indem er etwa öffentlich zum Dissidenten geworden wäre.
Sein Werk: einem riesigen Gebirgsmassiv vergleichbar, zu dem es viele Aufstiege gibt mit Aussichten in die Ferne und tiefe Schluchten, in denen jede Hoffnung verschwinden mag. Dass Literaturkritik ihm nicht gerecht werden könne, hat Stanislaw Lem im erwähnten Gespräch gesagt, es sei denn der Literaturspezialist sei zugleich in Mathematik, Physik, Astrophysik, Kybernetik, Chemie, Biologie, Philosophie, Literaturtheorie bewandert, Wissensgebieten, mit denen er sich zeitlebens intensiv beschäftigte. Als „Antenne“ sah er sich, „die antizipierend Entdeckungen und Umorientierungen des wissenschaftlichen Denkens im Bereich der Grundauffassungen empfängt“. Reproduktion sehr „harter“ und „komprimierter“ Probleme als literarisches Spiel, das dem zurückgezogen lebenden Autor selber Abenteuer und Spaß bescherte – in „Best of Lem“ findet sich diesbezüglich Herausforderndes neben Texten, die bei allem Tiefgang vor allem eines sind: spannend. Bewundernswert, wie Jan-Erik Strasser diese Auszüge aus Lems Lebenswerk fand und so zusammenstellte, dass sich ein Gesamtbild ergibt, ja lesend eine Sehnsucht entsteht, sich unbedingt – wieder oder erstmals – die Werke in ihrer Gänze zu Gemüte zu führen.
Vor allem „Solaris“ (1961), Lems wohl berühmtester Roman, denn dass dem Psychologen Kris Kelvin in der Raustation die tote Geliebte erscheint, ganz lebendig wirkt, ihm aber auch Angst macht, beschäftigt einen doch. Was hat es mit dem Schwarm metallisch glänzender Mikropartikel auf sich, der Rohan, den Ersten Offizier des Raumkreuzers „Der Unbesiegbare“ auf seiner Rettungsmission verfolgt? Ziemlich gruslig auch, was dem Raumfahrer Ion Tichy während eines Kongresses im Jahre 2039 widerfährt. Nachdem er an einem (verbotenen) Gegenmittel gegen „Psychemie“ geschnuppert hat, erscheint an Stelle des knusprigen Rebhuhns auf seinem Tisch ein ekliger Brei aus Gras und Futterrüben, mit etwas Schmieröl versetzt. Denn, so behauptet sein Gesprächspartner, für Delikatessen ist in einer Welt mit zwanzig Milliarden Menschen kein Platz. Ion Tichy war übrigens schon im Roman „Die Sterntagebücher“ von 1957 die Hauptgestalt, der ebenso wie „Der Unbesiegbare“ (1964) und „Der futurologische Kongress“ (1971) jetzt bei Suhrkamp im Rahmen einer Jubiläumsausgabe wieder herausgekommen ist. Aber auch alle anderen Lem-Bände, darunter „Kyberiade“ (1965) – gerade diesen „Fabeln vom kybernetischen Zeitalter“ wünscht der Autor bleibende Bedeutung – hält der Verlag dankenswerterweise lieferbar.
Heute erscheint es frappierend, was Stanisław Lem alles vorausgesehen hat – von Selbstverständlichkeiten des modernen Lebens bis hin zu Forschungen, von denen die Allgemeinheit manches ahnt und wenig weiß. Artifizielle Gehirne in Eisenkisten, die glauben, eine Identität als junge Frau, als Gelehrter, als Priester zu haben, wie sie in „Die Sterntagebücher“ vorkommen, erschrecken heute umso mehr, weil es nicht mehr nur Fiktion sein könnte. Zugleich wächst das Gespür, dass Realität nicht ganz der Beherrschbarkeit offensteht, das Zufälle vieles verändern können. Manipulierbarkeit durch Drogen? Roboter die einander bekämpfen? Neuartige Waffensysteme, die sich der Kontrolle entziehen können? „Welche Technik will man haben, und was soll man sich mit ihr wünschen?“, formuliert Alfred Gall. Ja, haben wir überhaupt die Kompetenz dazu? Wenn Lem schon früh von einer „Technologiefalle“ sprach, ist dieser Gedanke nicht zuletzt auch durch die Flut von Unterhaltungsliteratur und -filmen, die er als Kitsch bezeichnete, so ins allgemeine Bewusstsein gedrungen, dass er längst nichts Subversives mehr hat. Wie würde er die heutige Realität charakterisieren? Hat sich die Falle geschlossen?
Von Stanisław Lem neu bei Suhrkamp:
Best of Lem. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Jan-Erik Strasser. 528 S., br., 12 €.
Sterntagebücher. Übers. Caesar Rymarowic, 523 S., br., 10 €.
Der Unbesiegbare. Übers. Roswitha Dietrich. 228 S., br., 10 €.
Der futurologische Kongress. Übers. Irmtraud Zimmermann-Göllheim, 139 S., br., 8 €.
Alfred Gall: Stanisław Lem: Leben in der Zukunft. WbgTheiss, 284 S., geb., 25 €.