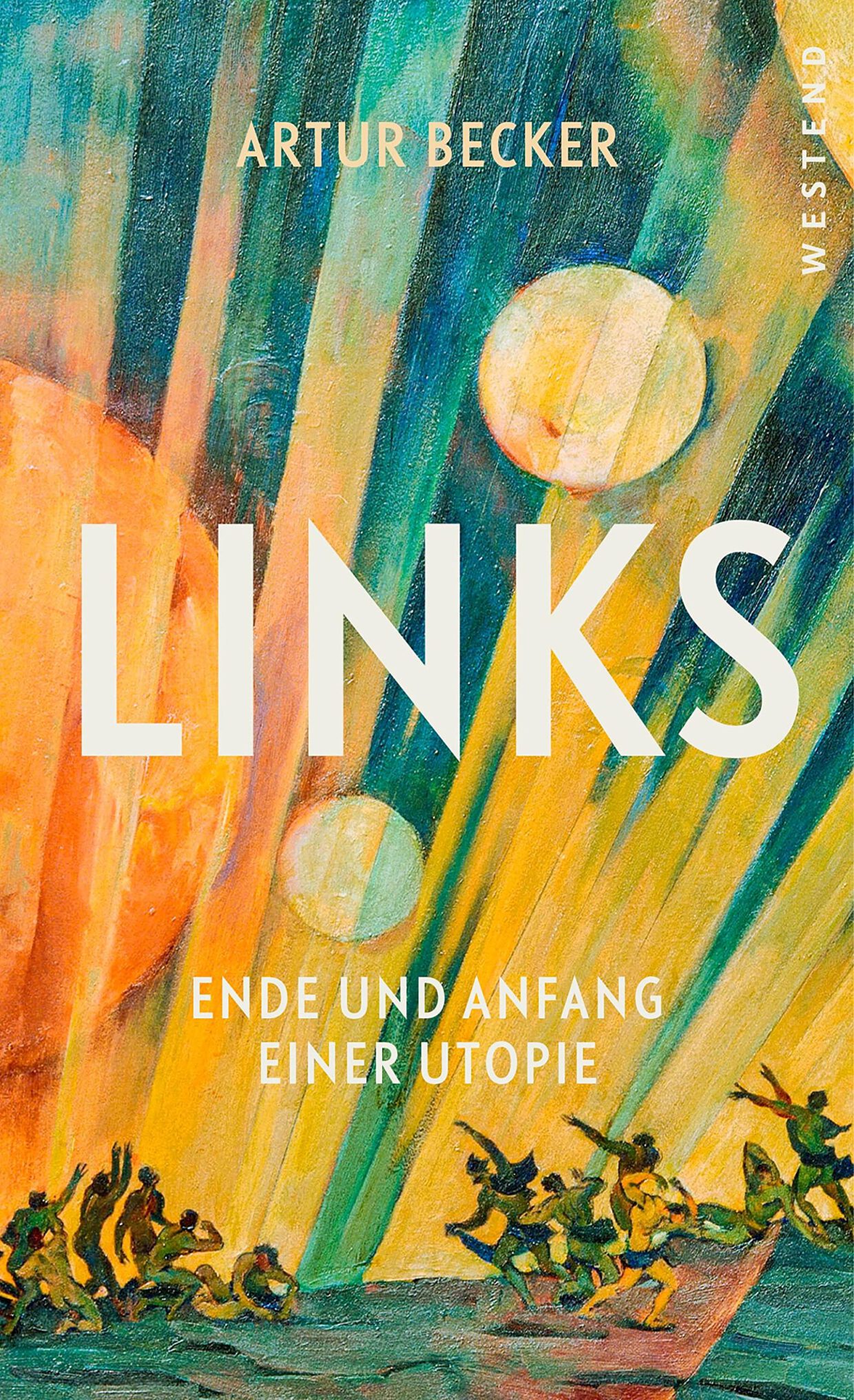Utopie – das Undenkbare?
„Links“ – eine „emphatische Streitschrift“ von Artur Becker
Irmtraud Gutschke
Bei seinem Namen mögen manche an den Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes denken, der 1938 im Spanischen Bürgerkrieg schwer verwundet in franquistische Gefangenschaft geriet und nach mehrwöchigen Verhören von den Faschisten ermordet wurde. Aber der Autor dieses Buches ist 1968 in Polen geboren und kam 1985 nach (West-)Deutschland. Wer das mit den Folgen des Kriegsrechts dort und dem rigiden Vorgehen gegen alles Aufrührerische in Verbindung bringt, irrt sich wohl nicht. 23 Prosa- und Lyrikbände hat Artur Becker seitdem veröffentlicht. Mehrere Literaturpreise würdigten seine mitreißende, poetische Sprache, seine nachdenkliche Beschäftigung mit deutsch-polnischen Themen. Polen blieb eine schmerzende Wunde.
„Obwohl ich nur knapp 17 Jahre in diesem politischen System gelebt habe, konnte ich seine Schokoladen- wie seine krankhaften Schattenseiten ausgiebig kennenlernen und studieren.“ Der „Realsozialismus“, so schreibt er in seinem neuen Buch „Links“, „glich einem Glauben“. Und er zitiert den Literaturnobelpreisträger Czeslaw Milosz, der von einem „Hegelianischen Bienenstich“ sprach, „da sich die Weltgeschichte um jeden Preis positiv – bis zur Auflösung jedweder Form von Regierung und zur proletarischen Diktatur – erfüllen müsse, und zwar in einem vollkommenen Frieden für alle Menschen und nicht nur für die sozialistischen Staatbürger.“ Zugleich aber sei der Staat „korrupt und ökonomisch und ideologisch ausgebrannt“ gewesen und habe für seine Kritiker nur eine Antwort gehabt: Repressalien. „Und die Linken, die regierten, waren in Wahrheit rechte nationalistische und konservative Ideologen, die ihre Privilegien genossen – unter dem Deckmantel der sozialistischen Erfolgspropaganda.“
Bei den Linken aus der 68er Studentenbewegung beobachtete er dagegen eine „ungeheure Naivität“. Mit ihrem „Elitarismus“ wirkten sie „behäbig und arrogant“ und „kochten in der eigenen Soße“. Da umreißt Becker ein Problem, das der linken Bewegung bis heute am Bein hängt: einerseits das Scheitern des Staatssozialismus und andererseits die Abgehobenheit. Da scheint sich „links“ für viele in der sogenannten „Wokeness“ zu erschöpfen, „die den Kampf für je einzelne, benachteiligte Gruppen meint, dabei aber, so eine gewichtige Kritik, das gesellschaftliche Allgemeine , ja, die soziale Frage aus dem Blick zu verlieren droht.“ Und mancher fühlt sich schon „links“, indem er „im Elektro-SUV zum Biobäcker“ fährt, „um einen Dinkelbrocken für 10 Euro zu kaufen“.
Ein sprachmächtiger Autor, der sich beim Schreiben auch selber von seinen Gedanken mitreißen lässt. Dichter und Philosophen ruft er sich zu Hilfe: Adorno, Benjamin, immer wieder Bloch, Gramsci, Lukácz, Simone Weil und natürlich Marx. Die Diagnose, dass sich die Linke in vielen wohlhabenden Demokratien von ihrer Volksbasis gelöst habe, indem sie, wie der polnische Philosoph Leszek Kołakowski feststellte, zu einer „Summe spontan entstandener moralischer Einstellungen“ wurde, ist nicht von der Hand zu weisen und wird im Buch auch immer wieder untermauert. Dass das Prekariat, sich selbst überlassen, deshalb zu den Rechten und Identitären abgewandert ist, dieses Problem wird ja auch innerhalb der Partei „Die Linke“ durchaus gesehen. Aber das eine zu tun und das andere nicht zu lassen, das gelingt wohl sehr schwer. Soziale Schichten gegeneinander auszuspielen, darin macht dem Neoliberalismus kein anderes System etwas vor.
Dieses realpolitische Widerspruchsfeld denkt man beim Lesen immer mit. Die Armen erwarten von der Linken nichts mehr, und die (ein wenig) besser gestellte Mittelschicht fürchtet um ihre Besitzstände, wenn von einer Vermögenssteuer die Rede ist. Und die Oberschicht, die eigentlich zur Kasse gebeten werden müsste, hat sich mit einer Festungsmauer umgeben, sodass man sie schon fast nicht mehr sieht. Und draußen tobt der Konkurrenzkampf gerade im akademisch kreativen Milieu. Wo sich Menschen für wenig Geld krumm machen müssen und Arbeitskräfte knapp sind, wird „Wokeness“ nicht gedeihen.
„Das Streben nach einer besseren Welt, nach einer Weiterentwicklung bis hin zur tatsächlichen Utopie … darf niemals beendet werden.“ Damit hat Artur Becker wohl Recht. Aber wen momentan gestiegene Lebensmittel- und Energiepreise drücken, wer voller Angst in die Zukunft blickt, wird eher mit Naheliegenderem beschäftigt sein: Wer trägt die Kosten wofür? So weit ist es schon gekommen, dass wir die Frage nach dem Ganzen schon vor uns herschieben, gar verdrängen, weil wir nicht wissen, wie sie zu lösen ist. Die fetten Jahre seien vorbei, fast hämisch klingt es uns in den Ohren. Auf unmittelbare Bedürfnisse zurückgeworfen, können Menschen entweder umso fügsamer werden oder sich zu sozialem Protest verbünden, was allerdings gegen den Widerstand der Herrschenden außerordentlich schwer zu organisieren ist.
In diesem Zusammenhang lese ich Artur Beckers „emphatische Streitschrift“, wie der Westend Verlag das Buch charakterisiert. „Die Utopie dialektisch denken, heißt aber immer, Unsicherheit, Offenheit und Versuch auszuhalten. Heute scheint alles derart katastrophal, dass wir nur noch Lösungen wollen, schnelle, greifbare, kontrollierbare.“ Als Analytiker hat der Autor den Widerspruch wohl erkannt, als Dichter spannt er gleichsam die Flügel der Poesie aus: Utopie heißt auch, zu träumen wagen, und sei es von etwas, das „eigentlich undenkbar“ ist.
Artur Becker: Links. Ende und Anfang einer Utopie. Westend Verlag. 143 S., geb.,
16 €.