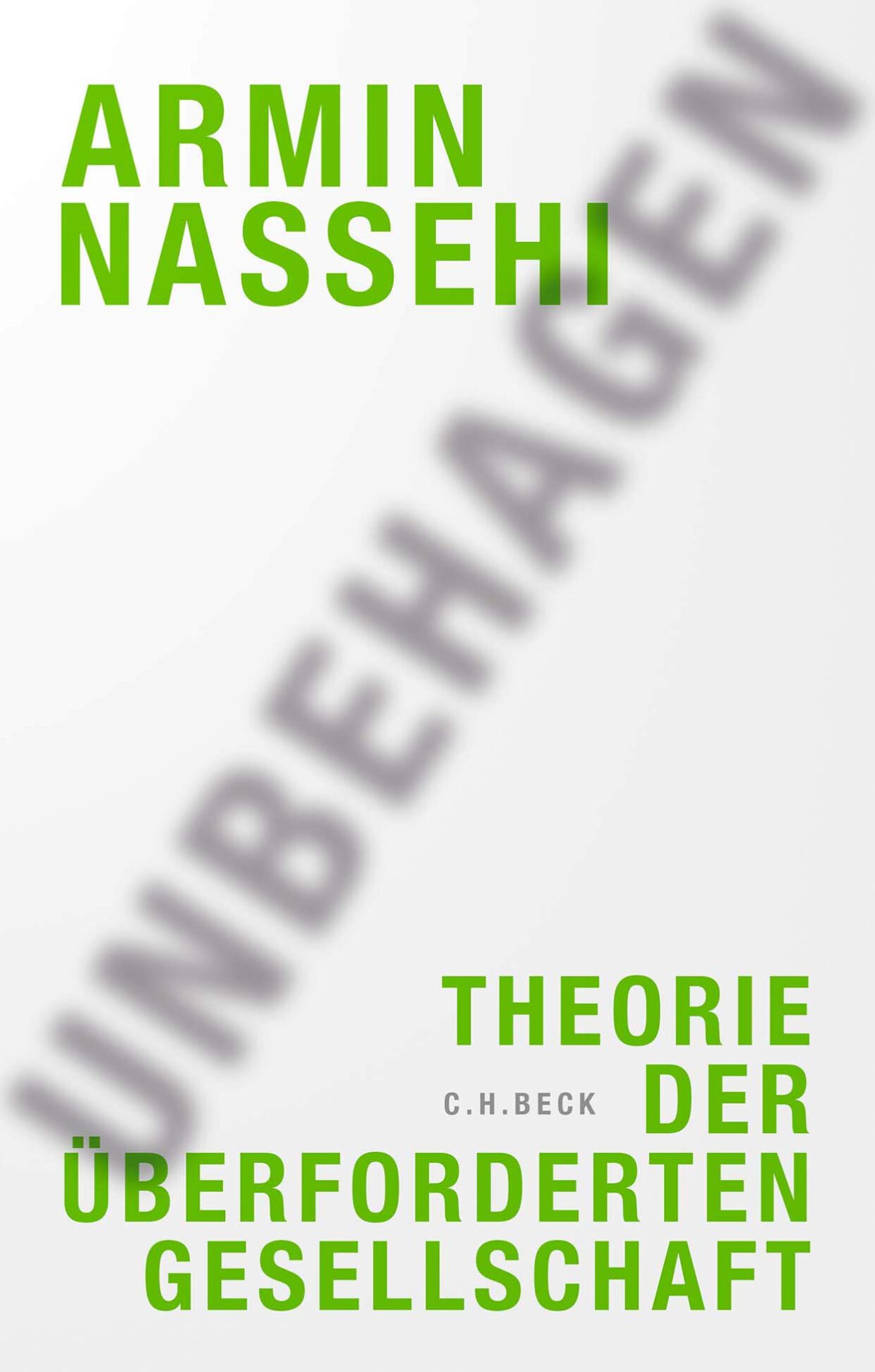Kunst des Kopfstands
Armin Nassehi sieht die Ursache des „Unbehagens“ in dieser Gesellschaft in ihrer Komplexität
Von Irmtraud Gutschke
Nachgesagt wurde ihm, ein „Papst er Grünen“ zu sein – er ist in der Tat katholisch – Vordenker einer schwarz-grünen Koalition, die ja jetzt vom Tisch ist, ein „Mediengenie“. Andererseits pflege er eine geradezu „artistisch verwendete Begrifflichkeit“, wie im „Freitag“ zu lesen. Armin Nassehi ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München – und vermutlich nicht bei allen seiner Fachkollegen beliebt, weil er sie, sich selbst herausstellend, auch gerne angeht. Dennoch hat er sein Buch „Unbehagen. Theorie einer überforderten Gesellschaft“ gerade auch für sie geschrieben“, was schon an seiner Sprache abzulesen ist. In einfachere Ausdrucksweise gebracht, hätte das Buch vielleicht nur 200 Seiten zu haben brauchen und wäre breitenwirksamer gewesen, weil der Titel das Empfinden großer Teile der Bevölkerung aufruft. Die Ursachen des Unbehagens erklärt zu bekommen, besteht durchaus Bedarf.
Diesbezüglich hat der Autor Beschwichtigendes im Sinn. Seine Grundthese, vereinfacht gesagt: Das Unbehagen kommt aus der Offenheit, Dynamik und Komplexität der modernen Gesellschaft und auch aus der Verwechslung der Gesellschaft mit einer Organisation, die durch gemeinsame Zielstellungen verbunden wäre. Vielmehr entwickeln die „Logiken“ und „Funktionen“ in der Moderne „Zentrifugalkräfte“, sie streben geradezu zu „maximaler Verschiedenheit“. Das lässt sich in der Tat gut am Umgang mit Covid-19 illustrieren. Die Widersprüchlichkeit der Aussagen und Entscheidungen irritierte durchaus.
Auch im Falle des Klimawandels werde es deutlich: Was ein Subsystem, die Wissenschaft, weiß, führe nicht automatisch zu gesellschaftlichen Veränderungen. Dem kann man entgegenhalten, dass der Trend zu Veränderungen offensichtlich, aber eben für breite Teile der Bevölkerung nicht ganz einsichtig ist. So sehr der Narrativ einer drohenden Klimakatastrophe ins Bewusstsein gehämmert wurde, so haben sie doch ein Gespür dafür, wer dafür zahlen wird. Mit moralischen Forderungen überhäuft, müssen sie sich als Umweltsünder fühlen, wenn sie Auto fahren, Fleisch essen usw. Der Zwang, ihr Konsumverhalten zu ändern, wird eine Profitquelle sein.
Nassehi weiß wohl, was er in seinem Weltbild alles ausblendet. Deshalb rügt er auch „die geradezu obsessive Konzentration der Gesellschaftsdiagnose auf den Kapitalismus bzw. den Industriekapitalismus als Quelle alles Übels“. Die Gesellschaft als „kapitalistische“ zu beschreiben, sei ebenso verkürzend, wie „von einer demokratischen Gesellschaft, von einer aufgeklärten Gesellschaft oder gar einer wissenschaftlichen Zivilisation zu sprechen“. Auch „die Konzentration aufs Ökonomische als Kapitalismus“ lehnt er ab und sieht sich befugt zu sarkastischer Rüge. „Es macht in der sozialwissenschaftlichen Intelligenz offensichtlich Schwierigkeiten, die Differenz der Funktionen nicht in einer Form der Einheit aufzuheben – politisch, gemeinschaftlich oder normativ.“
Kunst des Kopfstands: Absichtsvoll blind gegenüber den Mechanismen des sozialökonomischen Herrschaftssystems, konzentriert sich Nassehi auf die Vielfalt der Erscheinungen. Er denkt über vielfältige Aspekte heutigen Lebens nach, die verunsichern können. Zum Beispiel über den Staat, der für seine Bürgerinnen und Bürger auch eine Schutzfunktion hat, „Einschluss“ und „Ausschluss“ erzeugt, auch gegenüber Milieus und Klassen, Konfessionen . Da sieht er in den „Gleichheitszumutungen“ der Moderne auch eine Überforderung. „Der modern Mensch soll autonom sein, zugleich aber vielfältige äußere Erwartungen erfüllen. Er soll unterschiedliche Anforderungen erfüllen, aber die Einheit seines Ichs pflegen und auch noch dem allgemeinen Ich gerecht werden.“
„Die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem“, wie er es nennt, könnte man auch mit dem Begriff „Widersprüchlichkeit“ fassen. Ausführlich befasst er sich mit dem Problem der Migration, das allgemein betrachtet wirklich anders aussieht als konkret, wo Flüchtlinge auf Ämter und Instanzen stoßen, Asylverfahren zu bestehen haben, um Anspruchsberechtigungen zu bekommen, Wohnraum, Anstellungen bekommen wollen und zu „Konkurrenten auf Arbeits-, Wohnungs-, Heirats- und Geltungsmärkten“ werden. Dass die Gesellschaft kein „Behälter“ ist, in dem man „drin“ sein kann, sondern „ein vibrierendes System, an das Individuen multipel andocken und in dem es letztlich für niemanden einen festen Platz gibt“, ist eine treffende Feststellung. Da stimmt es, dass in der Lage der Migranten auch „die Fragilität des Eigenen sichtbar wird“.
Deutlicher gesagt: „Unten“ kann sich keiner mehr sicher sein, ganz „oben“ aber schon. „In vormodernen Gesellschaften hat die Differenzierung in Schichten ziemlich stabile Kontinuitäten hergestellt.“ Stimmt, damit ist es jetzt vorbei. „Dass Minderheiten auf ihre Herkunft pochen, dass Sprechgebote an solche Herkunft gebunden werden, dass sexuelle Stile jenseits des zuvor Kommunizierbaren selbstbewusst auftreten, dass Rassismus als solcher sichtbar und kommunizierbar war, dass eine neue Sensibilität für kommunikative Angemessenheit usw., entsteht, ist auch ein Ausdruck dafür, dass sich diese Minderheitenpositionen kommunikativ ein Stück Aufmerksamkeit erkämpfen, die zuvor nicht möglich war.“
Da kommt es tatsächlich zu einer „Umdefinition der komplexen Gesellschaft in Gruppen unterschiedlicher Provenienz“. Eine Art „Familieninklusion“, die die Markierung von Menschen nur verstärkt? Dass die Gruppenbildung auch übergeht auf jene, die sich in der Mehrheit wähnten, ist eine Folge.
Interessant ist tatsächlich der Verweis auf die US-amerikanische Soziologin Arlie Russell Hochschild, die die Misere älterer weißer Männer mit Highschool-Abschluss beschreibt. Seit 1970 seien ihre Löhne um 40 Prozent gesunken, weil Unternehmen auf Grund radikaler Gewinnorientierung bestehende Strukturen abgewickelt haben. Der Staat habe dem auf Grund fehlender sozialpolitischer Programme kaum kompensatorisch entgegenwirken können. Da ist ihr Bild des Schlangestehens, das rechte Identitätspolitik beschreibt, schon berühmt geworden. Wenn im hinteren Teil People of Colour, meist ohne College-Abschluss, auf ihre Rechte pochen, fühlt sich ihr „Vordrängen“ an, als würdest du zurückgedrängt… „Wie können sie das bloß machen? … Das ist nicht fair.“
Der Widerspruch von Identitätspolitik sei nicht zu lösen. Einerseits operiere man ja mit universellen Menschenrechten, andererseits stelle man Besonderheiten heraus und unterstütze so die „Einteilungen von Menschen“, die man doch eigentlich überwinden will. „Weil die Sprechfähigkeit zur Überwindung der Differenz direkt auf die Differenz angewiesen ist“, ist in ihr auch die verquere Asymmetrie enthalten, kommt es womöglich zu einer „Stabilisierung der Differenz statt ihrer Überwindung“. Das ist theoretisch richtig, bezieht aber zu wenig ein, dass hier einzelne aus eigener Betroffenheit und eigenem Interesse sprechen, dass sie für sich selber kämpfen, und das aus gutem Grund.
Und dann überschreibt Nasehi, völlig unerwartet ein Kapitel mit „Tianxia“ und beschäftigt sich ausführlich mit dem chinesischen Philosophen Zhao Tinyang, der in dem gleichnamigen Buch dem westlichen liberalen Modell ein anderes gegenüberstellt, das sich in China bewährt. Treffsicher zielt er auf das, „was die westliche Demokratie in sich selbst beklagt: die Unübersichtlichkeit der Gesellschaft und das Fehlen von Selbstwirksamkeit“. Nasehi versucht wohl, das Prinzip „Alles unter einem Himmel“ zu verstehen, das auf eine „Inkludierung alles Partikularen“ zielt, indem er zu Recht auf die kunfuzianische Tradition verweist, es dadurch aber auch fremd macht. Dass da noch viel ältere Wurzeln sind, die wir ebenso haben, dass diese Herrschaftsform nicht notwendig zu Stagnation führt, sondern auch Innovation und Wettbewerb stimulieren kann, ist wohl eine Herausforderung. Wie sie in China gemeistert wird, davon weiß Nasehi schlicht zu wenig, vielmehr will er ja auch in seinen Erklärungen das System verteidigen, in dem wir leben.
Dass eine „offene“ Gesellschaft letztlich nicht organisierbar ist, stimmt diese Ansicht? Nasehi führt den Schumpeterschen Begriff der schöpferischen Zerstörung ins Feld, „der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und eine neue schafft“ und nennt diesen Prozess „das für den Kapitalismus wesentliche Faktum“. Also doch Kapitalismus. Ihm ist da alles ja klar, er umgeht bloß Profitmaximierung, Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse. Beziehungsweise er verteidigt sie, weil sich „Formen der Asymmetrie ‚bewährt‘ haben, als Anlass für Rollenzuweisungen, für Arbeitsteilung, für Herrschaft, für Ordnungsbildung“. Die Moderne habe indes etwas völlig Unrealistisches versprochen: „ein Gleichheitsversprechen trotz offenkundiger und unvermeidlicher Ungleichheit in je unterschiedlichen Hinsichten“. Im Zusammenhang mit dem Verlust der gewohnten Ordnung, verwendet er den Luhmannschen Begriff der Latenz, die Schutz gewährt, deren Verlust aber Aggression hervorruft. Also sei „Latenzschutz“ wichtig.
Denn: „Das Vertrauen in die Welt ist abhängig davon, dass man gerade nicht genau hinschauen muss, dass die Dinge hingenommen werden können, wie sie erscheinen.“ Da habe die Covid-Krise, „um das berühmte Brecht-Zitat aufzugreifen, die Gesellschaft ‚zur Kenntlichkeit entstellt‘ – sie war gar nicht in einer Ausnahmesituation, sondern hat sich in ihrer Struktur gezeigt: geprägt von Zielkonflikten, von Unregierbarkeit, von Entscheidungssituationen unter Unsicherheit, von Übersetzungsproblemen und nicht zuletzt davon, wie wenig das konkrete Handeln durch Appell an die Einsicht in gut begründete Notwendigkeiten beeinflusst werden kann.“ Was linke Theorien kritisieren, wird von Nasehi umso genauer bezeichnet, weil er als das Gegebene begreift, das in seiner Evolution lediglich beobachtet werden kann.
Bei aller Kritik am Buch, gerade das verspricht interessante Lektüre. Nasehis Menschenbild ist realistisch und nachsichtig. Konsum und Unterhaltung gesteht er etwas Tröstliches zu, weil sie die Dinge einerseits mit einer Bedeutung aufladen, die ihnen einen gewissen Sinn abzutrotzen vermag, aber auch nicht u viele Informationen erzeugen Eine „durchschaubare Welt“ sei eine „unsichere Welt“? Sollen wir uns lieber Illusionen machen? Vom Standpunkt der Herrschaft aus, muss man ja tatsächlich überlegen, wie man den Leuten Veränderungen schmackhaft machen könnte. Nasehin wäre da ein guter Berater: „Verzicht“ müsse wie „ein Gewinn aussehen“. Ließen sich damit nicht auch Gewinne machen? Ansonsten den Leuten Sand in die Augen streuen? „Vertrauen wird dadurch hergestellt, dass man nicht so genau hinsehen muss“. Für die „nächsten Formen der Krisenbewältigung sei zu lernen: „Der Krisenmodus scheint nicht wirklich geeignet zu sein, um Krisen zu meistern.“
Armin Nasehi: Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft. C.H. Beck, 384 S., geb., 26 €.