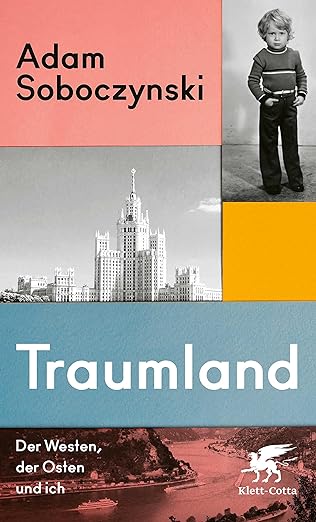„Mein Traumschloss, der westliche Liberalismus“
Adam Soboczynski erkundet europäische Spannungsfelder, indem er aus seinem Leben erzählt
Irmtraud Gutschke
„Der Ostblock war kollabiert, aber am Rhein bekam man davon so gut wie nichts mit. Die Dramen spielten sich in doch sehr fernen Städten wie Leipzig Dresden oder Berlin ab.“ So erinnert sich Adam Soboczynski, der damals in Koblenz aufs Gymnasium ging. „Es war eine katholische Anstalt, und ich war vermutlich der einzige Migrant … man war schon ein Exot, wenn man aus einem Arbeiterhaushalt kam.“ – 1975 im polnischen Toruń geboren, lebt er seit seinem sechsten Lebensjahr in Deutschland. Wer den Titel „Traumland“ für ironisch hält, der irrt. Die Eltern hatten nicht gelogen, als sie ihm Orangen, Schokolade und duftende Kleidung versprachen. „Wir würden niemals mehr Schlange stehen!“ Aber sie hatten schuften müssen. „Mutter hatte mehrere Putzstellen. Vater arbeitete zwei Jahre lang auf Montage … “ Irgendwann hatten sie eine Eigentumswohnung zusammengespart.
Es sei das „Unglück des Sozialismus“ gewesen, „dass es alle gleich gut oder schlecht haben sollten und es weitgehend auch hatten, den Menschen aber ein zäher nie und nimmer versiegender Wettbewerb und Geltungsdrang eingeschrieben sind. Es besser haben … als die Nachbarn, …die Geschwister …“ Das klingt wie ein Lob der Ellenbogengesellschaft. „Die Wunderwerke des neuen Landes … die Leuchtreklamen, das Lichtermeer … Die Auslagen quollen über…“ Die „westliche Generalkritik am Westen“ ist ihm suspekt.
Wenn ein gelegentliches Wechselbad der Gefühle und Gedanken der geistigen Gesundheit dient, muss ich dem Autor dankbar sein. Wie er so authentisch, unverstellt, so geistreich und mit feinem Humor aus seinem Leben erzählt, war ich ganz an seiner Seite, um irritiert von ihm abzurücken, wenn ich seine Ansichten nicht teilte. Es war seine erzählerische Kraft, die mich immer wieder beim Lesen faszinierte. Ich wollte mich in ihn hineinversetzen, mit ihm zusammen den Weg von seinen Erfahrungen zu seinen Einschätzungen gehen. Er meinte ja nicht den Osten, den ich kenne, sondern einen, der noch weiter östlich liegt.
„Eine Erzählung ist ein offenes, vertrauliches Gespräch unter Gleichen“, schreibt der US-amerikanische Autor George Saunders, der in seinem empfehlenswerten Buch „Bei Regen in einem Tech schwimmen“ aus der Beschäftigung mit Tschechow, Turgenjew, Tolstoi und Gogol Grundlegendes für das Lesen und Schreiben ableitet. Es stimmt, dass wir uns immer mit einer gewissen Vorgestimmtheit einer Lektüre zuwenden. „Wir sehen oder hören nicht alles, was gesehen oder gehört werden könnte, sondern nur das, was uns hilft.“ Wissentlich den Widerspruch anzunehmen, schärft indes die Gedanken. Adam Soboczynski hilft, Fremdes zu verstehen.
Wie es in Polen war, kurz bevor dort eine Militärdiktatur errichtet wurde, viele werden es nicht wissen. Dass die Sowjetunion ihm seit jeher als dunkle Macht erschien und Putins Russland ihm noch bedrohlicher ist, hat in diesem Land geschichtliche Wurzeln und stellt meine ostdeutschen Prägungen in Frage. Die mögen den Autor, inzwischen Literaturchef der „Zeit“, womöglich auch nicht interessieren. Die deutsch-polnischen Missverständnisse sind es, die ihn bewegen. Immer wieder begibt er sich in einen Zwiespalt. Grandios die Szenen bei seinen Verwandten in Polen, doch dann wieder ärgert ihn ein Landsmann im Zug mit einem „albernen Satz“. „Mein Heimatland war wieder einmal Avantgarde. Die Polen nahmen den Trumpismus und den Aufstieg völkischer Parteien des Westens vorweg …“ Was sich in Deutschland verändert hat, sieht er auch.
Spätestens, wenn auf Seite 42 der Name des bulgarischen Soziologen Ivan Krastev fällt, spürt man die theoretische Fundiertheit dieses weitgehend erzählerischen Textes. Krastevs vor einigen Jahren zusammen mit dem US-amerikanischen Rechtswissenschaftler Stephen Holmes veröffentlichtes Buch „Das Licht, das erlosch“ liefert tatsächlich wichtige Erkenntnisse über die Ursachen der nicht nur in Osteuropa grassierenden antiliberalen Revolte. „Im Westen laborierte man an der Überwindung der Geschlechtergrenzen, der Nation, der Kleiderordnung und des generischen Maskulinums, doch je weiter man in den europäischen Osten kam, desto lebhafter wurden der Patriotismus, das Patriarchat, die Kleinfamilie gerühmt“, schreibt Soboczynski. „Was die einen als Fortschritt begriffen, empfanden die anderen als schwere Verirrung.“ Ironie der Geschichte: Ein „postnationales, auf multikulturelle und sexuelle Vielfalt gepoltes Weltbild“ wird nicht nur von vielen Polen abgelehnt. Die ihnen so verhassten Russen sind darin ebenso eifrig.
„Mein Traumschloss, der westliche Liberalismus“, bekundet der Autor, und polemisiert gegen antiwestliche Stimmungen im deutschen akademischen Milieu. Besonders enttäuscht ist er, wie eine „lautstarke Fraktion deutscher Intellektueller“ Waffenlieferungen für den „erbitterten Kampf der Ukrainer“ in Zweifel zieht. Dass die Menschen dort dem „Einfluss eines brutalen, wirtschaftlich wie kulturell hinfälligen Imperiums“ entgehen wollen –, ist dieser geopolitische Konflikt wirklich so einfach zu entschlüsseln? Soboczynski sucht nichts zu durchdringen, er bezieht Position. Wissend, dass der „Westen“ schon nicht mehr die integrierende Wirtschaftskraft besitzt wie einst, verteidigt er umso vehementer seinen Kindheitstraum.
„Ich war einst von einem geknechteten Land ins Paradies gezogen und konnte den Aufstieg Putins, Orbán und Trumps nur aus vollem Herzen verachten.“ Kraftvoll treffende Beobachtungen aus Berlin, Moskau, Georgien, Paris, London und in Polen kollidieren immer wieder mit geradezu rührender Hilflosigkeit. „Der Osten“ war nicht zum „Ort der sich emporkämpfenden Moderne“ geworden. Also rühmt er den Westen als „beste aller möglichen Welten: den Westen mit seinen ramponierten und verbrauchten Großbegriffen wie Rechtsstaatlichkeit, parlamentarische Demokratie, Privateigentum, Minderheitenschutz und so weiter“. Bewahrenswertes gibt es tatsächlich. Doch reicht das als Vision?
Adam Soboczynski: Traumland. Der Westen, der Osten und ich. Klett Cotta, 170 S., geb., 20 €.