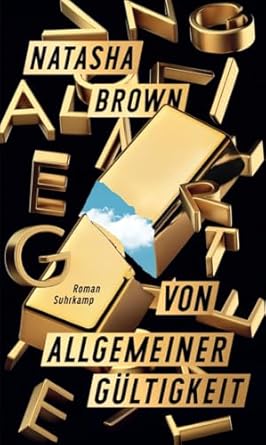So oder so, es bleibt ungerecht
Natasha Brown über Woke-Kultur, Populismus und das Wort als Ware
Irmtraud Gutschke
Der Umschlag zeigt einen Goldbarren, der, wie sich zeigt, im Landhaus eines Londoner Bankers nur Dekorationsgegenstand war. Schwer genug allerdings, um als Waffe zu taugen. Plötzlich lag zu Jakes Füßen ein regungsloser Mensch. Erst konnte er keinen klaren Gedanken fassen. Dann beschloss er zu fliehen. Eine illegale Party während des Covid-Lockdowns mit hundert, meist jungen Leuten endete mit drei Verletzten und beträchtlichen Sachschäden. Die Lokalpresse griff den Fall auf. Und die Journalistin Hannah hofft, daraus eine gut verkäufliche Geschichte zu machen: „Der verschwundene Goldbarren ist das verbindende Element zwischen einem amoralischen Banker, einer bilderstürmenden Kolumnistin und einer radikal-anarchistischen Protestbewegung.“
Storytelling, wie es Medien mögen: Natasha Browns Text ist voll versteckter Ironie. Wie sie schon in ihrem vorigen Roman „Zusammenkunft“ das Hintergründig-Widersprüchliche suchte, ließ mich auch auf ihr neues Buch neugierig werden. Wobei sie ihre Gesellschaftsdiagnose diesmal an mehrere Gestalten knüpft und die Perspektiven wechselt. Man muss sich zurechtfinden und selbst die einzelnen Meinungen gewichten. Bevor Hannah den jammernden Jake aufspürt, der sich schließlich der Polizei stellt, trifft sie den reichen Eigentümer des Anwesens, der dort im Bedarfsfall ein „Ende der Welt überleben“ wollte. Mit der „Hardcore-Marxistin“ Indiya besucht sie den durch Jake verletzten „Pegasus“ im Krankenhaus, der eine „autonom wirtschaftende Community“, jenseits von Kapitalismus und Konsum ins Leben rufen will. Jeder könne mitmachen. Wobei Hannah die Zusammensetzung der Gruppe aufstößt: „jung, weiß und aus der Mittelschicht“.
Sie selbst ist schwarz, wie man spätestens an diesem Punkt begreift. Weiß ist die Star-Journalistin Lenny, die gegen die Woke-Kultur wettert, weil weiße Männer benachteiligt würden. Wobei Natasha Brown, in London geboren und mit Vorfahren aus Jamaika, eben keine Schwarz-Weiß-Malerei betreibt. Sie gibt dieser Lenny sehr viel Raum, um Konflikte aufzureißen, die untergründig in der Gesellschaft schwelen. „Als schwarze behinderte Lesbe oder was auch immer kriegt man den Job sofort“, sagt Lenny. Man will widersprechen. Aber ist es nicht so, dass eine Benachteiligung die andere bedingt? Wie soll in einer durch und durch ungerechten Gesellschaft Gerechtigkeit sein?
Von Lenny nahm Hannah sogar Tipps für ihre Reportage und die geplante TV-Verfilmung an. Die Produktionsfirma wollte, dass Jake schwarz sein sollte. „Auf diese Weise fühlen sich mehr Leute von der Geschichte angesprochen.“ Kurzer Geldregen, dann ist es vorbei. Hannah muss „in die Masse aus gewöhnlichen Leuten“ zurück, „denen Nachrichten passierten, während andere diese Nachrichten machten“. Die einstigen Studienfreunde blicken nun auf sie herab. Sie kann sich anstrengen, wie sie will, ihre arme, schwarze Herkunft hält sie fest. „Hatte sie sich jemals gegen den Kapitalismus eingesetzt oder einfach nur gegen die eigene Benachteiligung?“
Kühle Beobachtung, was eine Konkurrenzgesellschaft mit den Menschen macht. Der Protagonistin des vorigen Romans war bewusst, dass sie als Schwarze dem Unternehmen einen modernen Anstrich verleihen sollte: „Die Diversität muss sichtbar sein.“ Aber inzwischen ist populistische Stimmungsmache angesagt. Leute wie Lenny bekommen Applaus – und Wählerstimmen. Dabei suchen sie nur den eigenen Gewinn. „Man muss irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen“, gesteht sie am Schluss. Das Wort als Ware und als Köder: „Man deckt beide Seiten der politischen Debatte ab, um die eigene Leserschaft abwechselnd aufzubringen und zu besänftigen.“
Lektüre, die einen nicht mehr los lässt. In lebendigen Szenen verbirgt sich ein analytisches Wollen. Mit Adleraugen schaut diese Autorin auf unsere westlichen Wirren.
Natasha Brown: Von allgemeiner Gültigkeit. Roman. Aus dem Englischen von Eva Bonné. Suhrkamp, 158 S., geb., 23 €.