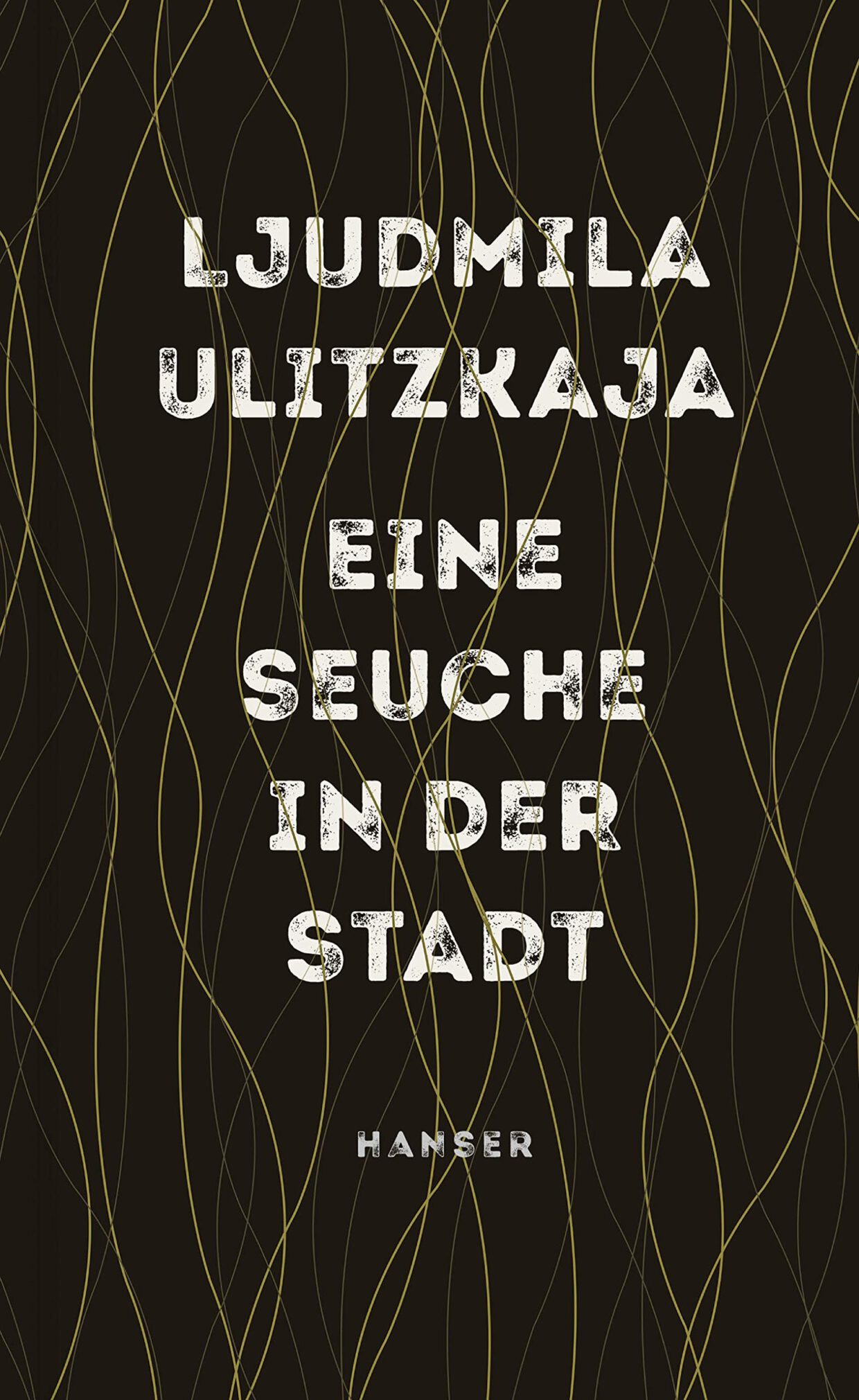Man nannte es Influenza
Ljudmila Ulitzkaja hat das spannende Szenario einer – tatsächlich besiegten – Epidemie geschrieben
Von Irmtraud Gutschke
Atemlos liest man dieses Buch. Es scheint wie für den heutigen Tag verfasst. Dabei ist der Text, wie man aus dem Nachwort der Autorin erfährt, 1978 entstanden – als mögliche Vorlage für einen Film, der nicht gedreht worden ist. Beim Aufräumen fiel er ihr wieder in die Hände, und sie staunte selbst, wie aktuell er ihr erschien.
Vom Ausbruch der Lungenpest 1939 in Moskau hatte Ljudmila Ulitzkaja von ihrer Freundin Natascha Rapoport erfahren, deren Vater damals daran Verstorbene obduzierte. Ein Mitarbeiter des Labors, das an der Herstellung eines Pestimpfstoffs arbeitete, hatte sich unwissentlich infiziert. Auf einer Dienstreise nach Moskau, wo er an einer Konferenz teilnahm, erkrankte er schwer und verstarb in einem Krankenhaus. Der diensthabende Arzt, der zunächst noch „kruppöse Pneumonie“ festgestellt hatte, erfuhr vom Sterbenden die Wahrheit: „Die Maske verrutschte ein wenig“. Er isolierte sich sofort, informierte seine Vorgesetzten und jene die ihren. Die Hierarchie funktionierte. Stalin persönlich setzte eine großangelegte landesweite Operation des Geheimdienstes in Gang. Gefunden werden mussten all jene, die mit dem Wissenschaftler Kontakt gehabt hatten – im Zug, im Hotel, während der Konferenz. Das packende Szenario handelt davon, wie das geschieht.
Es war die Zeit des „Großen Terrors“ in der Sowjetunion. Eine schwarze Limousine vor dem Haus konnte Lagerhaft oder Todesurteil bedeuten. Die da aus ihren Wohnungen geholt wurden, reagierten entsprechend. Man sagte ihnen ja nicht, dass es sich um Quarantäne wegen Lungenpest handelte. Das Wort „Pest“ wurde überhaupt nicht gebraucht, ja es war strengstens verboten, es zu benutzen. Wenn unbedingt nötig, zum Beispiel gegenüber den anderen Insassen des Krankenhauses, nannte man es Influenza. Da kommt zur Spannung beim Lesen immer wieder die Nachdenklichkeit, ob die Autorin wohl Recht hat, die in ihrem Nachwort „Schlimmer als die Pest“ derlei Geheimnistuerei scharf kritisiert. Da es sich um isolierbare Infektionsherde handelte, war es im konkreten Fall wohl wirklich möglich, Massenpanik zu vermeiden. Dies widerspricht den heutigen Werten einer „offenen Gesellschaft“ – und ist doch zweckdienlich gewesen.
Ljudmila Ulitzkaja steht für freiheitliche Grundsätze. Zugleich führt ihr Text vor Augen, wie durch harte Maßnahmen die Epidemie in Moskau tatsächlich eingedämmt werden konnte. Von diesem Spannungsfeld lebt ihr Buch. „Mir ging es um den Gedanken, dass die Pest nicht das schlimmste Unglück für die Menschheit ist, denn Epidemien sind natürliche Prozesse“, schreibt die Autorin, die ja von Haus aus Genetikerin ist. „Terror-Epidemien“ dagegen seien „selbstgemacht“, etwas, „wofür die Natur nichts kann“. So dachte womöglich auch der bekannte Filmautor Valeri Frid, dem Ulitzkaja ihr Manuskript 1978 zur Begutachtung schickte. Weil er selbst ein paar Jahre in stalinschen Lagern gesessen hatte, konnte er wohl schon deshalb den Gedanken nicht ertragen, „das NKWD hätte auch nur ein einziges Mal etwas ‚humanitär‘ Nützliches getan“.
Ausbrüche der Lungenpest hat es in der Sowjetunion übrigens schon lange vorher gegeben, zum Beispiel ab 1931 im Autonomen Gebiet Bergkarabach, aber eben nicht in Moskau. Die „orientalische Pest“ hielt man zunächst für etwas von außen Eingeschlepptes, was sie auch zur Sache der Sicherheitsorgane machte. Die Gefahr aus dem Süden legte einen stärkeren Schutz der Grenzen nahe. 1934 beschloss das Politbüro einen Plan zur „Ausarbeitung von Maßnahmen im Kampf gegen die Pest“. Zahlreiche Forschungs- und Präventionseinrichtungen wurde etabliert, die dort arbeitenden Wissenschaftler großzügig ausgestattet. Das führte mit den Jahren zu immer besseren Erkenntnissen über heimische Pestherde. Verseuchte Nagetiere wurden aufgespürt und vernichtet. Auf ähnliche von oben gelenkte, konsequente Weise hat die UdSSR 1959 eine beginnende Pocken-Epidemie, 1970 die Cholera und 1979 in Swerdlowsk, dem heutigen Jekaterinburg, einen massenhaften Ausbruch von Anthrax verhindert, der infiziertem Vieh zur Last gelegt wurde. Aber es kann auch ein Unfall im nahegelegenen Biowaffen-Labor gewesen sein.
Was Covid-19 betrifft, als Biologin macht Ljudmila Ulitzkaja Mut, dass die Pandemie besiegt wird, weil sich der Virenstamm abschwächt und weil „noch niemals eine Infektion auf eine so starke und schnell reagierende Wissenschaft getroffen“ ist. „Die Pandemie betrifft unseren gesamten Planeten, und ich hoffe, sie wird zu einem grundlegenden Umdenken in allen Bereichen unseres Zusammenlebens führen.“
Ljudmila Ulitzkaja: Eine Seuche in der Stadt. Ein Szenario. Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt. Carl Hanser Verlag, 112 S., geb., 16 €.