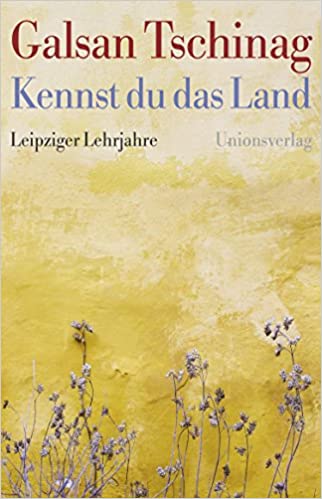„Ich würde im Grunde meiner Seele beleidigt sein, wenn einer behaupten wollte, es gäbe auf Erden schönere und wichtigere Städte als Leipzig.“
Herr des Himmels über Leipzig
Galsan Tschinag: Im Lauf der „Gedankenstute“ über „Zeithügel, Zeitberge“
Diese Stadt „besteht aus hünenhaften Häusern, die gleich jenen gruselig geheimnisvollen Felsen aus unseren Heldenepen Wand an Wand neben- und gegeneinanderstehen und verwegen emporklettern und mit den Spitzen und Kanten ihrer Dächer den Himmel bedenkenlos zerstechen und zerschneiden, während weit unten im schummrigen Schatten klammschmale, sturztiefe Schluchten sich kreuz und quer auftun und nach Luft und Licht zu keuchen und zu japsen scheinen. Und der Himmel darüber wirkt merkwürdig niedrig und gefleckt und gedämpft… Ja, das geistreiche machtvolle Volk, im Unterschied zu unserem befreit aus jeglicher Fessel des dummen Aberglaubens und der dumpfen Genügsamkeit, hat es vermocht, sogar den Himmel und die Erde in seine Untertanen zu verwandeln…“
Auf Deutsch geschrieben, führt dieses Buch schon auf der ersten Seite in eine ganz eigene Sprach- und Bildwelt. Bei Galsan Tschinag verwundert das nicht. Wobei die über dreißig Bücher, die von ihm inzwischen auf dem hiesigen Buchmarkt sind, vornehmlich das Leben und die Überlieferungen der Tuwa in der Mongolei zum Thema haben. Diesmal aber lässt er uns mit seinen Augen auf jene Stadt blicken, wo er von 1963 bis 1968 studierte. „Mutter Leipzig“ – so hat sie wohl noch niemand zuvor genannt. Es ist ein Buch der Dankbarkeit in Erinnerung an all das, was ihn werden ließ, wie er ist. Er werde die deutsche Sprache um mindestens drei neue Ausdrücke bereichern, hatte Galsan Tschinag 1968 im Leipziger Rathaus versprochen, als er die Urkunde als Diplomgermanist entgegennahm. Dieses Vorhaben hat er weit übertroffen.
Dabei ist alles zunächst so fremd gewesen. Ohne ein Wort Deutsch zu können, kam er in „ein gewaltiges Land, das mehr aus Beton, Eisen, Glas und Dampf zusammengesetzt ist, als aus Gestein, Holz, Wasser und Luft“. Und unsereins staunt, dass dies die DDR sein soll. Die anderen mongolischen Studenten blickten auf ihn herab. Sie – Kinder von Funktionären und er ein Nomadensohn, dessen Muttersprache Dwadl bislang nur mündlich existierte. „Damals habe ich mit meiner Sippe in der Urgesellschaft, sozusagen in der Steinzeit gelebt…“ – der Gedanke machte ihn beklommen. Das Studium empfand er als ungeheuren Aufstieg, ehrgeizig sog er alles in sich hinein, was an deutscher Kultur zu haben war. Dass auch seine Vorfahren eine alte, reiche Kultur besaßen, auf die er stolz sein konnte, wurde ihm erst so recht bewusst, als er eine Leipziger Wissenschaftlerin in seine Heimat begleitete und sie bei ihren Feldforschungen unterstützte.
Aber, ach, in welche Missverständnisse haben ihn die selbstbewussten DDR-Frauen gestürzt. Leserinnen werden lächeln, denn er versteht offenbar bis heute nicht, was ihm geschah. Oder doch? Weiß er inzwischen um die unterschiedlichen Zeichensysteme? Daher kommt ja der Reiz: dass wir die eigene Wirklichkeit mit fremden Augen sehen und zusätzlich noch eine ganz andere Sicht geschenkt bekommen. Nicht jene Exotik, wie sie überall wohlfeil zu haben ist, sondern etwas ungemein Aufrichtiges, Lauteres, ein Wertsystem, in dem wir Weisheit erkennen. Talent zur Dankbarkeit sogar für jene, die sich gegen ihn wandten, denn sie haben ihn nur stärker gemacht. „Auf Dunkles sollst du mit Hellem, auf Hartes mit Weichem und auf Kaltes mit Warmem“ erwidern. Gelassenheit: „Wir sind einfach vom Schöpfer unterschiedlich gewoben.“ Entschlusskraft: „Möchte werden, wozu ein Mensch je fähig ist.“ – Also alles nachholen, was diese „kultivierten und disziplinierten Wunderwesen Germanen“ ihm voraushaben könnten. Im Flug durch Aufklärung und Romantik zu den kommunistischen Idealen, die ihm in ihren Wurzeln ja gar nicht so fremd sind. „Dir kann es nur gut gehen, wenn es auch um die Gemeinschaft gut bestellt ist. Die Gemeinschaft aber setzt sich nicht nur aus Einzelmenschen, sondern aus allen Einzelteilen des ganzen Alls zusammen – und daher ist ihr Glaube von der untrennbaren Zusammengehörigkeit aller entstanden.“ Wann wird Westeuropa zu solcher Weisheit kommen? Und: Wie lange wird der Stamm der Tuwa noch daran festhalten können?
Auf seiner „Gedankenstute“ reitet Galsan Tschinag über „Hunderte Zeithügel, Dutzende Zeitberge“, damit ihm im Alter die so wertvollen Jugenderfahrungen nicht verloren gehen. Er schreibt das Buch ja zunächst für sich, will sich an alles ganz genau erinnern, so dass manche Passagen für den Leser auch weitschweifig erscheinen können. Das liegt an unserer Hast. Und weiß man, ob das auf Effektivität gepolte Gehirn dabei nicht gerade Wichtiges aussortiert? „Die Urquelle jeglicher Kultur ist die klare Denkweise, die genaue Einsicht, und sie beginnt, wenn der Mensch in der Lage ist zu erkennen, wer und weshalb er da ist und welcher Wert dem Augenblick zukommt.“
Da reißt beim Lesen der graue Himmel über Leipzig auf. So „merkwürdig niedrig“ sei er hierzulande – was alles lag allein schon in diesen beiden Worten von Galsan Tschinag! Dass der Himmel eben nicht weit ist wie in seiner Heimat und dass die Leute, lauter Einzelwesen, verlernt haben, zu ihm aufzublicken. „Deeri, Himmel: Danke“ – der Mensch zwischen dem ewig blauen Himmel und der Mutter Erde hat die Pflicht, mit allem, was unter dem Himmel ist, im Einklang zu leben. Aus tiefer Vergangenheit dringt dieser Gedanke zu uns herauf, als etwas Weltenverbindendes, von den alten Chinesen, den Mongolen, den Völkern Mittelasiens und Sibiriens, bis hin zu denen Europas einst heilig gehalten. Tiwaz war der germanische Himmelsgott. Die Vorfahren der Bulgaren sprachen von Tangra. Für die Kirgisen im Norden ist bis heute Tengri lebendig. So versprengt diese Völkerschaften waren (und auch kriegerisch gegeneinander) haben sie sich doch unter einem Himmel gefühlt, in einer Bindung zum All.
Galsan Tschinag: Kennst du das Land. Leipziger Lehrjahre. Unionsverlag. 310 S., geb., 22 €.