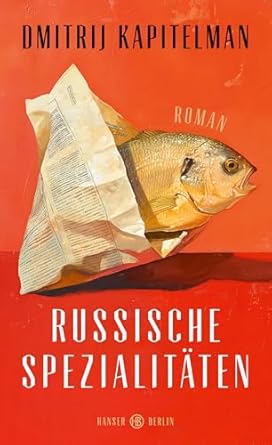„Zerrissene Welt“
Dicker als Blut: „Russische Spezialitäten“ im deutschen Dilemma von Dmitrij Kapitelman
Irmtraud Gutschke
Wie kann ein Buch zugleich dermaßen vergnüglich und dermaßen bedrückend sein? Dmitrij Kapitelman verfügt über ein ganz eigenes Talent: Leichtigkeit der ironischen Beobachtung, fragende Distanz, nachdenklich, mit freundlichem Lächeln. In diesen seinen Stil habe ich mich gleich verliebt. Und auch mit dem Bedrückenden spricht er mir aus dem Herzen, „seit der Krieg uns in einen Graben zieht“.
1986 wurde er in Kiew geboren. 1994 kam er als jüdischer Kontingentflüchtling mit seinen Eltern nach Deutschland, studierte Politikwissenschaft und Soziologie in Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Dies ist sein drittes Buch bei Hanser Berlin. Der Umschlag zeigt einen in Zeitungspapier gewickelten Karpfen, der verzweifelt nach Luft schnappt oder schon damit aufgehört hat. Tatsächlich wurde im Laden „Russische Spezialitäten“, wo die Handlung beginnt, auch Fisch verkauft.
Gewagter Buchtitel: „Russische Spezialitäten“ zu Zeiten, da derlei der Ächtung unterliegt. Neuerscheinungen aus dem Russischen kann man mit der Lupe suchen. Aber Dmitrij Kapitelman schreibt deutsch und ist schließlich Ukrainer. Fein raus. „Sowohl als auch“, höre ich ihn in Gedanken sagen. Wäre es so einfach, hätte er diesen großartigen Roman nicht geschrieben, der ja gerade vom Druck der Zuordnungen handelt, den er von Kind an kennt. Als Sohn des jüdisch-ukrainischen Mathematikers Leonid Kapitelman und der aus Moldawien stammenden Vera Romashkan trug er zunächst den Namen der Mutter. Für Kapitelman hat er sich erst in Deutschland entschieden. Mitunter finden sich kyrillisch gedruckte Wörter im Text, weil des Autors Muttersprache ja Russisch ist. Naschi ljudi oder svoi – beides bedeutet „die Unsrigen“, aber dazwischen gibt es einen Unterschied.
Betrieben die Eltern wirklich so ein „Magazin“ in Leipzig-Kleinzschocher? Was real ist und was erdacht, müsste man den Autor fragen. Russische Flusskrebse in Tomatensauce, ukrainischer Wodka und georgische Sonnenblumenkerne vertragen sich hier prächtig. Und die ostdeutsche Kundschaft ist beglückt vom Moskauer Eis. Wie witzig ist das beschrieben! Mit welch pfiffiger Beobachtungsgabe. Es könnte gern so weitergehen. Aber mit Corona kam die Pleite. Die russischen Bücher landeten im Altpapier. Und dann wurde es noch schlimmer: „Seit der Invasion habe ich das Gefühl, kein richtiger Mensch mehr zu sein.“
Was mir schon das Herz zerreißt, wie muss es erst für den Ich-Erzähler sein, für den ein Riss sogar durch die Familie geht! Die Mutter holt sich das „Fernsehrussland“ in die Küche. Wie kann sie bloß einen „Massenmörder“ unterstützen! Und der Sohn überlegt, dass er in der Ukraine zum Militär eingezogen worden wäre. Könnte er dort überhaupt noch in seiner Muttersprache reden?
Ein Schwenk in der Handlung: Fahrt nach Kyjiw. Polizisten mit Maschinenpistolen prüfen seine Papiere. Rekrutierungsplakate, Luftalarm, rote Pfeile zum nächsten Bombenschutzraum. Seine Freunde meinen, dass „Russisch bald aus unserem Land verschwunden sein wird“. Wurde das Bild von Russland mit den Verheerungen in Mariupol zerstört? „Es ist eben nicht alles so Schwarz-Weiß“, sagt eine junge Frau namens Larissa im Zug. Mit ihrem Baby ist sie geflohen, weil sie mit ihrer medizinischen Ausbildung in die Armee müsste. „Die schlimmen Dinge, die sie über das russische Militär gehört haben, die können sie eigentlich genauso auf unseres übertragen.“
Wenn die Waffen schweigen würden, könnte da Frieden sein? „Ich will die Ukraine von vor dreißig Jahren zurück“, hatte die Mutter gesagt. „Bitte was? Etwa die Ukraine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion?“ Nein, als es den „sowjetischen Leim“ noch gab, denke ich.
Was für eine wirkmächtige Metapher: Mit dem „billigsten sowjetischen Leim“ hatte Onkel Jakob damals im Laden das Linoleum angeklebt. Weil ein Tröpfchen ins Blut gelangte, blieb an seiner linken Hand eine offene Wunde. Später lässt sich der „krankenhausgrüne“ Fußbodenbelag kaum entfernen. „Du verstehst nicht, Dimatsch!“, schreit Jakob. „Das ist sowjetisch-russischer Leim, der löst sich nicht.“
„Sowjetischer Leim ist offenbar wirklich dicker als Blut“, heißt es später bezüglich der Mutter, die immer noch glaubt, dass russische Angriffe nur Militärobjekte treffen. Fast eine Million Tote, Verwundete und Vermisste in der Ukraine – auch wenn der Krieg aufhören würde, wie soll der Hass verschwinden? Im „Fernsehrussland“ ist immer nur vom „Gegner“ die Rede. Dass eine florierende Kriegswirtschaft Bedarf an weiteren Kriegen haben könnte, will ich ungern glauben. Aber ich glaube dem Autor seine Befürchtungen. Ich spüre eine Lauterkeit im Buch, ein persönliches Sich-Befragen und verstehe, dass Menschen unterschiedliche Wahrheiten haben können. Unter dem Druck des Gegenwärtigen wissen wir nicht, was die Zukunft bringt.
Wenn ihm das Herz für die Ukrainer blutet, darf denn der Sohn die Mutter ablehnen, die anders fühlt und ihn unablässig erinnert, seine Mütze aufzusetzen? Divergierende Meinungen aushalten: Wenn das so einfach wäre. „Dreißig Jahre Deutschland, kein Jahr ohne Hakenkreuze.“ Und wieder einmal wird bei der Familie in Leipzig ein Fenster eingeschlagen. Ohnmächtiger Zorn, der sich im Zaum halten muss. Menschlich bleiben in einer heillos zerrissenen Welt: Dmitri Kapitelman erzählt davon auf unnachahmliche Weise.
Dmitrij Kapitelman: Russische Spezialitäten. Roman. Hanser Berlin. 192 S., geb., 23 €.