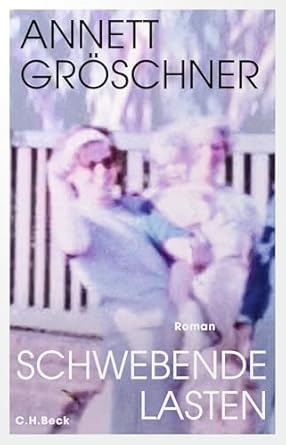Auf ihren Schultern greifen wir nach den Sternen
Annett Gröschner erzählt die Geschichte eines Jahrhunderts in einem Frauenleben
Irmtraud Gutschke
Nach „Moskauer Eis“ (2000) und „Walpurgistag“ (2011) endlich wieder ein Roman von Annett Gröschner, die sonst vor allem mit Essayistischem von sich reden machte. Wobei der neugierige Blick auf ostdeutsche Prägungen und Veränderungen eine Konstante ihres Schaffens ist. Der Band „Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat“, den sie vorigen Herbst mit Peggy Mädler und Wenke Seemann veröffentlichte, ist diesbezüglich in guter Erinnerung. Mit dem neuen Roman nun hat sie sich selbst übertroffen. Im Leben einer Frau wird uns ein ganzes Jahrhundert vor Augen geführt, so detailliert, so lebendig spannend, dass man immer wieder an ein reales Schicksal denkt. Schließlich handelt der Roman in Magdeburg, wo die Autorin 1964 geboren wurde. Hanna Krause könnte ihre Großmutter sein. Mit welchen Bedrückungen Frauen umgehen mussten, wie schwierig der Weg weiblicher Emanzipation war, darüber denkt man beim Lesen nach. Selbstverwirklichung? Nicht mal dieses Wort hat Hanna Krause gekannt. Mädchenträume gab es. Dass sie begraben wurden, galt als normal.
Da dachte ich immer wieder an meine Mutter. „Man muss es nehmen, wie es kommt“, sagte sie oft. Und als ich sie nach ihren Lebensträumen fragte – da war sie schon weit über achtzig – reagierte sie erstmal verwundert. „Das Wichtigste für mich waren meine Kinder. Das sage ich noch einmal und noch einmal.“ Wir waren vier. Hanna Krause hat sechs Kinder geboren und zwei davon nicht begraben können. Wie sie die Bombardierung ihrer Stadt erlebte, brennt sich einem ein, so genau ist es beschrieben. So stimmig, dass es mit der Realität abgleichbar ist und man die Lektüre all jenen dringend empfehlen möchte, die heute von Kriegstüchtigkeit reden.
Wenn es einen Traum in Hannas Leben gab, so erfüllte er sich in einem eigenen kleinen Blumenladen nahe der Johanniskirche, die dann während des Krieges zerstört worden ist. Aber es war wohl in der Nikolaikirche, dass sie mit ihren vier Kindern verschüttet wurde, weil eine Sprengbombe den Hauptturm traf. Als sie sich herausgekämpft hatten, verlor sie ihren Sohn. „Plötzlich ist er stehengeblieben, hat die Arme ausgebreitet und ist davongeflogen. Bis das Feuer ihn verschluckt hat.“ Das wiederholte die kleine Elisabeth immer wieder, deren Brandwunden auch nach Wochen nicht heilen wollten. Aber kein Weinen, kein Klagen. „Das erste Mal weinte Elisabeth wieder, als sie das Foto mit dem nackten vietnamesischen Mädchen sah, das auf der Straße vor den Napalmbomben floh.“
Lesend fragt man sich, wie Hanna all das überstanden hat: die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, den Verlust ihres Blumenladens, den Horror des Krieges, die Geburten, die Abtreibungen, dass ihr Mann bei einem Betriebsunfall ein Bein verlor und umso zudringlicher wurde – und wie sie sich nach dem Krieg zu einer Ausbildung als Kranführerin entschloss, auf den riesigen Brückenkran stieg im Schwermaschinenbaukombinat „Ernst Thälmann“, das früher zur Friedrich Krupp AG gehört hatte.
„Krupp und Krause“ – schon bevor der DDR-Fernsehfilm auf Seite 208 im Buch erwähnt wird, habe ich überlegt, ob Hannas Familienname insofern nicht mit Bedacht gewählt war. Denn der fünfte Teil spielte tatsächlich im Magdeburger Werk. Dass Hanna als Statistin mitgewirkt hat, erfahre ich nun. Man kann ja durchaus manches in der DDR kritisch sehen. Doch bringt uns Annett Gröschner in Hannas Selbstbewusstsein das nie wieder erreichte gesellschaftliche Prestige von Arbeiterinnen und Arbeitern vor Augen. Förderung von Frauen war Programm, zumal Arbeitskräfte gebraucht wurden. Klaglos erträgt Hanna die Belastung, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Ihren Kindern schreibt sie morgens auf, was zu Hause zu tun ist, und legt neben der Werkhalle sogar einen kleinen Garten an, um den sie sich in den Arbeitspausen kümmert.
Einer ganzen Generation von Frauen hat die Autorin da ein Denkmal gesetzt. Zum Pflichtbewusstsein erzogen, haben sie nicht mal daran gedacht, Zeit für sich selbst zu haben. Doch ihren Töchtern sollte es besser gehen. Eingespannt in Notwendigkeiten, bahnten unsere Mütter uns den Weg. Auf ihren Schultern durften wir nach den Sternen greifen.
Wie als Kontrast zu all dem Schweren, das Hanna Krause überstand, hat Annett Gröschner die Romankapitel jeweils mit einem Blumenbild eingeleitet: von Blaustern bis Zwergsonnenblume, aber es finden sich auch die Libelle, die Fliege, die Raupe und das Schneckenhaus. Und es gibt eine unvergessliche Szene mit einem sehr eleganten Mann, der noch in der Vorkriegszeit ihre Blumenarrangements lobte und ihr eine Postkarte mit Ambrosius Bosschaerts Gemälde „Vaas met bloemen“ daließ, damit sie einen ebensolchen Strauß für ihn anfertigte. Er ist nicht wiedergekommen. Wegen des Schildes „Juden nicht erwünscht“, das sie ins Schaufenster stellen musste? Aber vor ihrem Tod hat sie das Gemälde noch in Den Haag bewundern dürfen und es als Vorlage für ein Blumengebinde genommen. Ein Foto davon wollte sie dem Unbekannten schicken, aber sie wusste nicht wohin.
Annett Gröschner: Schwebende Lasten. Roman. C.H.Beck, 279 S., geb., 26 €.