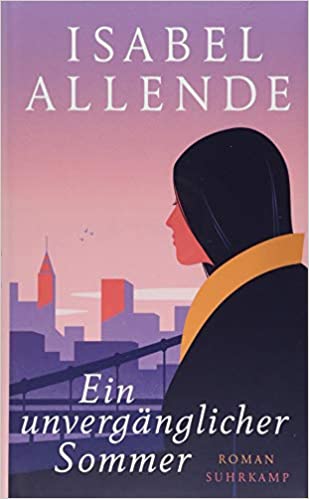Isabell Allende: „Ein unvergänglicher Sommer“ – eine Liebesgeschichte mit Leiche und politischem Biss
Krieg gegen die Armen
Von Irmtraud Gutschke
Der Titel meint eine Sehnsucht, die wohl auch die 76-jährige Autorin teilt, sonst hätte sie ihre Lucía nicht so eindrucksvoll darüber sprechen lassen können: Noch einmal einen Sommer der Liebe zu erleben, ohne dass daraus ein Herbst würde. Denn die Seele ist doch jung, trotz der Falten am Hals. „Ein unvergänglicher Sommer“ – Aufbegehren gegen die schwindende Lebenszeit. Nun ist Lucía zwar 14 Jahre jünger als Isabel, aber sie könnte auch 39 sein, um dieses Problem zu haben. Eine dauerhafte Bindung mit einem Mann, der es wert ist – stattdessen liefen ihr alle möglichen Hallodris über den Weg und in letzter Zeit überhaupt keiner mehr. Lesend macht man sich um sie allerdings keine Sorgen. Dass im Haus über ihr ein eigenbrötlerischer, dabei nicht unattraktiver Professor wohnt, bietet in Romanen, wie sie Allende schreibt, von vornherein eine gewisse Glücksgarantie.
Dieses Erwartbare ist es, das viele Bestseller von jener Literatur unterscheidet, die in den Feuilletons gewöhnlich hochgejubelt wird. Andererseits kann man in diesem Falle nur froh sein über derlei Massentauglichkeit. Aber dazu später.
Besagter Professor hatte einer jungen, kaum Englisch sprechenden Frau seine Visitenkarte gegeben, nachdem er auf vereister Straße in New York das Heck ihres Wagens gerammt hatte. Der Kofferraum ließ sich nicht mehr richtig schließen. Stunden später, als diese verängstigte Frau bei ihm klingelte, musste er Lucía um Hilfe bitten. Als Chilenin würde sie die Unbekannte vielleicht verstehen. Die rückt allerdings erst am nächsten Morgen mit der Wahrheit heraus. Sie stammt aus Guatemala und hatte den Lexus ihres Arbeitgebers genommen, um für dessen Sohn Windeln zu kaufen. Vor der Apotheke hatte sie dann im Kofferraum die Leiche einer Frau entdeckt. Es ist die Physiotherapeutin, die im Hause von Frank Leroy ein und aus ging.
Richard, der Professor, meint, dass man sich an die Polizei wenden müsste. „Evelyn schrie auf und begann haltlos zu schluchzen… ‚Ich nehme an, du hast keine Papiere‘, sagte Lucía.“ Womit für sie klar war, dass eine unkonventionelle Lösung gefunden werden musste. Um sich der Leiche zu entledigen, machen sich die drei auf in die nördlichen Wälder. Lucía und Richard kommen sich dabei (erwartungsgemäß) nahe. Wie geschah das Verbrechen und welche Verantwortung gibt es gegenüber dem Opfer? Diese Fragen und die sich daran knüpfende Abenteuergeschichte halten auch Leser in Spannung, die vielleicht keine Lust gehabt hätten, ein Buch über Einwanderer in den USA zur Hand zu nehmen. Weil sie meinen, alles darüber zu wissen und weil sie generell der moralischen Appelle leid sind, die sie von oben herab instrumentalisieren wollen und in Ohnmacht zurücklassen.
Isabel Allende aber, deren Vater Salvador Allendes Cousin gewesen ist, war selber eine Emigrantin. Nach Pinochets Militärputsch musste sie ihre Heimat verlassen. Die Lage in den Ländern Lateinamerikas brennt ihr bis heute unter der Haut. Über Lucía, deren Bruder Enrique zu den Unterstützern Allendes zählte und eines Tages spurlos verschwand, wird die Rolle der CIA in Lateinamerika thematisiert, „wo der Geheimdienst dazu beigetragen hatte, demokratische Regierungen zu stürzen und durch totalitäre Regime zu ersetzen, die kein US-Amerikaner bei sich daheim toleriert hätte“. Später ist von der „Operation Condor“ die Rede, „in der die Geheimdienste der Diktaturen von Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Bolivien und Brasilien zusammenarbeiteten“. Mit Unterstützung der USA, mit dem Ziel, linke politische und oppositionelle Kräfte weltweit zu verfolgen und zu töten. Isabel Allende spricht von 60 000 Ermordeten. Was Interessierte auch im Internet nachlesen könnten, über ihren Bestseller bringt sie es an ein weltweites Leserpublikum.
Indem sie auf spannungsvoll unterhaltsame Weise abwechselnd aus der Sicht von Richard, Lucía, und Evelyn erzählt, geraten drei Emigrantengruppen ins Blickfeld. Richards Vater hatte als Jude eine gefährliche Flucht in die USA hinter sich und folgte seitdem der Devise: „Wer Hilfe braucht, den fragt man nicht, wer er ist und woher er kommt.“ Luciá, in Trauer um ihren in Chile verschleppten Bruder, beschäftigt sich als Wissenschaftlerin mit den Verbrechen der Militärdiktatur und hat darüber schon mehrere Bücher verfasst. Über Evelyn schließlich weitet sich der Blick von Guatemala aus auf die vielen anderen Orte der Welt, wo Armut in Gesetzlosigkeit mündet, wo Bandenwesen und Terrorismus sich verbreiten wie unheilbare Krankheiten, wo Flucht für den Einzelnen oft der einzige Ausweg bleibt.
Wir lesen von den Erfahrungen der Flüchtenden und von jenen, die an ihnen verdienen. Wir schauen in eine Dunkelzone, aus der durchaus zusätzliche Antriebe für Migration erwachsen könnten. Individuelle und staatliche Gewalt als „Ergebnis eines andauernden Kriegs gegen die Armen“ geht somit Hand in Hand mit jenen, die aus der Notlage der Vielen ein Geschäft machen. Damit sind nicht etwa nur die kleinen Schlepper gemeint, sondern jene großen Profiteure, die Lobbyisten haben und Helfershelfer in staatlichen Institutionen.
„Zwei Nationen teilten sich denselben Raum“, überlegt Lucía beim Besuch Im heutigen Santiago de Chile, „die kleine Nation derer, die kosmopolitisch beeinflusst waren und sich weltläufig gaben, und die große aus allen anderen. Die Viertel der Mittelschicht strahlten eine Modernität auf Pump aus und die der Oberschicht ein Raffinement, das aus dem Ausland stammte. Die Auslagen der Geschäfte dort erinnerten an die Park Avenue, und die Villen wurden geschützt von Elektrozäunen und scharfen Hunden. In der Nähe des Flughafens und entlang der Autobahn lebten die Menschen dagegen in Elendssiedlungen, verborgen vor den Blicken der Touristen durch Mauern und riesige Werbetafeln mit Blondinen in Unterwäsche darauf.“
Wie weit ist es von hier bis dorthin?
Bestürzender politischer Durchblick – dass bei Isabel Allende daraus keine Bitterkeit wird, liegt wohl an ihrem Naturell. Mit den verschiedenen Schicksalsschlägen, die sie überstehen musste, kann sie sich durchaus mit Lucía und Evelyn messen. Niemand weiß, ob der Optimismus in ihren Büchern beim Schreiben nicht auch ihr persönliches Rettungsseil ist. Und was ihre Leser in aller Welt betrifft: Es ist ein massenhaftes Bedürfnis, in Lektüre Halt zu suchen, Erbauung, die, wenigstens für Momente, aus einem niedergedrückten Zustand befreit. „Ein paar mehr Zornige wie du würden der Welt gut tun, Benito“, sagt eine Ärztin aus einem evangelikalen Krankenhaus in Guatemala zu einem katholischen Priester, Jesuit und Baske, der in den achtziger Jahren Zeuge der Massaker an der indianischen Bevölkerung geworden“ war. Er verzweifelte nicht, übt sich in tatkräftiger Mitmenschlichkeit. Solche unverbrüchliche Zuversicht ist sicher nicht jedem gegeben. Und es sind gerade die Dünnhäutigen, die allgegenwärtiger Heuchelei nur noch mit einem Zynismus begegnen können, der wahrhaftig ist, aber niemanden aufrichten kann.
Isabel Allende: Ein unvergänglicher Sommer. Roman. Aus dem Spanischen von Svenja Becker. Suhrkamp, 349 S., geb., 24 €.