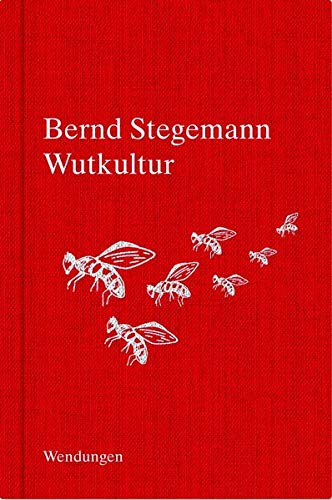Im Modus des Casting
Bernd Stegemann analysiert in „Wutkultur“ Kränkungen und Konkurrenz im Neoliberalismus
Von Irmtraud Gutschke
„Zornig wird, wer Mangel leidet und dessen Mangel man Geringschätzung entgegenbringt.“ Bernd Stegemann zitiert Aristoteles und schlägt damit einen weiten historischen Bogen. Für Notlagen gibt es in diesem Land ein soziales Netz. Das ist tief gespannt; wer hineinfällt; kommt schwer wieder hoch und findet Geringschätzung sogar in sich selber. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist tiefer geworden. In Deutschland ist seit Mitte der 80er Jahre der Anteil der armen Haushalte von 4,3 Prozent auf elf Prozent gestiegen. Die Schicht der Wohlhabenden hat ebenfalls zugelegt: von 3,9 Prozent auf 9,1 Prozent. Die Mittelschicht hingegen ist geschrumpft: von 48,6 Prozent auf 37 Prozent. Die dort grassierende Nervosität bildet den Hintergrund für Bernd Stegemanns Analysen.
Die Wut: „das älteste aller menschlichen Emotionsmuster“. Stegemann nennt sie „die kleine Schwester des heiligen Zorns, jene „fundamentale Energiequelle, durch die der Mensch seinen Selbstwert verteidigt“ und dabei auch „blind und maßlos werden“ kann. „In der Moderne wird der Wechsel von beschleunigtem Leben und störenden Blockaden zur täglichen Erfahrung“, weiß der Autor. In der „Spannung zwischen andauerndem Alarm und einer gleichzeitigen Hemmung unseres Lebensflusses“ erleben wir eine „Kränkung der eigenen Existenz“. Allein schon im Straßenverkehr: Warten auf den Bus, Stopp an einer roten Ampel, Frust über andere Verkehrsteilnehmer – damit die Gefühle hochkochen, braucht es nicht viel.
Ungerechtigkeit als Lebensbegleiter: Denn das Versprechen der Moderne, dass alle die gleichen Rechte hätten (innerhalb eines Staates, von der Welt ist nicht die Rede) wird gebrochen im Ökonomischen. Mit der neoliberalen Forderung nach Selbstvermarktung und -optimierung verschärft sich der Konflikt. Bernd Stegemann macht deutlich: Auf listige Weise, gern auch in Form von Ermunterungen, wird dem einzelnen die Schuld aufgeladen an unbefriedigender Lage. So dringt das Herrschaftssystem in die Gedanken ein. Es in seinen Zusammenhängen zu durchschauen, würde ein Stück weit geistige Befreiung bringen. So du aber an das Märchen glaubst, dass ein Tellerwäscher zum Millionär werden kann, musst du es dir selber übelnehmen, wenn das Glücksversprechen an der Realität scheitert.
Und da gibt es ja auch noch das Märchen von Aschenbrödel, das von einem Prinzen geheiratet wird. Dafür ging sie in einem schönen Kleid zum Ball, tanzte mit dem Prinzen – und leistet sich den Skandal, um Mitternacht zu verschwinden. Nun sucht er sie überall. „Entdeckt“ zu werden, wie viele junge Kreative sehnen sich danach. – durch ein erfolgreiches Unternehmen, Film und Fernsehen, eine Plattenfirma. In Berufen, die Entfaltungsmöglichkeiten und Prestige versprechen, fragen viele schon nicht mehr nach dem Lohn (oft so niedrig, dass kein Handwerker dafür arbeiten würde) und haben doch immer auch jene vor Augen, die es bei ähnlichen Ausgangsbedingungen besser getroffen haben.
Mit seinen scharfsinnigen und wortmächtigen Analysen bewegt sich Bernd Stegemann, erfahren als Dramaturg in mehreren Theatern und seit 2005 Professor an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, vor allem in diesem Umfeld. Es ist die neue Mittelklasse derjenigen, die im urbanen Milieu nach Selbstverwirklichung streben. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat sie in seinem Buch „Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne“ der traditionellen Mittelklasse, der Oberklasse und der prekären Klasse gegenübergestellt und die Unterschiede in Lebenswirklichkeit und -vorstellungen verdeutlicht. Wobei die neue Mittelklasse ihre Werte – vom Erziehungsstil über das Gesundheitsverhalten und die Freizeitaktivitäten bis hin zum politischen Kosmopolitismus – als Distinktionsmerkmal beansprucht. Was die ökonomische Lage betrifft, können manche froh sein, durch ihre Elternhäuser aus der traditionellen Mittelklasse abgesichert zu sein, auf die sie nun herabschauen. Und wer es aus der prekären Klasse zu den „Kreativen“ geschafft hat, weiß umso besser, wie man kämpfen muss, um nicht wieder abzurutschen. Die Sammlung „Klasse und Kampf“, herausgegeben von Christian Baron und Maria Barankow, liefert dafür beeindruckende Beispiele.
Es ist hochinteressant, wie Bernd Stegemann, ausgehend von systemimmanenter Ungerechtigkeit, Reaktionen betrachtet, um persönlich damit fertig zu werden. Die massenhaft erlebte „Kränkung, nicht dazuzugehören“, von der er spricht, verbindet ja nicht, sondern trennt. Das liegt an der Konkurrenzsituation, aber eben auch daran, wie eine ökonomisch instabile Lage, wie gesagt, durch kulturelles, symbolisches Kapital kompensiert werden kann. Die neuen Mittelklasse findet mit der alten Mittelklasse und der prekären Klasse keine gemeinsame Sprache mehr. An Stelle von Solidarisierung zur Veränderung der Verhältnisse kommt es zu Abgrenzungen nicht nur „links“ gegen „rechts“, sondern auch innerhalb der Linken.“
„Die Selbstverzauberung des Moralismus besteht darin, dass sie denjenigen, der die Welt in Gut und Böse einteilt, als gut erscheinen lässt“, heißt es im Buch. Das kann man auf westliche Außenpolitik ebenso beziehen wie auf die deutsche Medienöffentlichkeit, die zunehmend vom Meinungshaften statt von Analyse lebt. Polemik hat Konjunktur. „Wut wird zu einem Wert, der bewirtschaftet wird“, schreibt Bernd Stegemann. Durch seine klaren Formulierungen legt er einem immer wieder gleichsam Samen ins Gehirn, aus denen eigene Gedanken wachsen, sofort oder später, während man über das Gelesene nachdenkt.
Benachteiligungen sind real. Auf vielen Ebenen findet Diskriminierung statt. Nach Geschlecht und Herkunft, aber auch – das bekommt viel weniger öffentliche Beachtung – nach Alter und sozialem Habitus. Wir sind in einem ständigen Modus des Casting, bei dem ausgewählt wird, wer welche Rolle spielen darf: einen begehrten Job bekommt oder eine Wohnung. Immer gibt es andere, die über dich entscheiden können. Dagegen müssen sich Menschen wehren dürfen. Anzuerkennen ist das Bedürfnis, die eigene Wut abgebildet zu sehen.
„Der Mensch ist das einzige Tier, das für ein Stück Fahnenstoff, eine Idee oder einen Gott sterben will, und darum ist die Geschichte eine Kette von Identitätskämpfen“, schreibt Bernd Stegemann. Dass Stämme, Sippen, Dorfgemeinschaften gegeneinander zu Felde zogen, konnte durchaus auch ideelle Gründe haben. Aber „der Aufschwung, den alle Identitätsfragen in Gesellschaften der radikalen Individualisierung haben“, wie es im Buch heißt, hat wohl vornehmlich auch mit Kämpfen um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu tun. Im kulturellen Bereich wohl stärker als dort, wo dringend Arbeitskräfte gesucht werden, die sich einfach nur krumm machen.
Dass in heutigen Identitätskämpfen nicht selten der Widerspruch in Kauf genommen wird zwischen der generellen Forderung nach Gleichheit und der Beanspruchung von Sonderrechten, wie Bernd Stegemann feststellt, hat zudem historische Gründe. Universelle Menschenrechte waren und sind doch bislang nur Utopie und Fiktion. Die Antirassismus-Bewegung in den USA, so wortgewaltig sie auftreten mochte, konnte den alltäglichen Rassismus noch längst nicht überwinden. Und auch feministische Forderungen werden erst einmal nur ansatzweise erfüllt. Die Langfristigkeit notwendiger emanzipatorischer Veränderungen hat ihre Kehrseite in der Vehemenz, um im Jetzt, im eigenen Leben im Interesse der Benachteiligten etwas in Bewegung zu bringen. Womöglich muss da auch überzogen, zugespitzt werden, um jahrhundertealte Verkrustungen aufzubrechen, überlege ich. Andererseits werden Gegenreaktionen bestärkt, die politisch folgenreich sein können. Weil sich alle in einem Verdrängungswettbewerb befinden und weil der Mensch ein „Gewohnheitstier“ ist: Während sich ohnehin vieles beschleunigt, versteht manch einer die Welt nicht mehr.
Ein ganzes Kapitel widmet Bernd Stegemann der rechten Identitätspolitik, die „an dem wachsenden Unmut über die zerfallenden Bindungen und der Angst vor dem sozialen Abstieg anzuschließen“ sucht. „Die nostalgische Sehnsucht nach einem Kapitalismus, in dem man gut leben kann, paart sich mit der reaktionären Sehnsucht nach einer Nation, in der man stolzes Mitglied ist.“ Im Unterschied zu anderen Ländern sind „Nation“ und „Volk“ allerdings in Deutschland auf Grund historischer Erfahrung negativ besetzt. „Die Zumutungen der Globalisierung, die als Heuschreckenkapitalismus den Arbeitsplatz gefährdet und durch Migrationsströme die Heimat verändert“, an einer „Verteidigungslinie der nationalen Selbstbestimmung“ abwehren zu wollen, ist naiv und gefährlich. Stegemann unterscheidet zwischen konservativer Politik, die auf Bedächtigkeit setzt, und rechtem Populismus mit seiner Wut, die sich aus Ohnmachtsgefühlen der Einzelgänger nährt. Da bietet das Buch eine scharfsinnige Analyse der AfD mit ihrem verantwortungslosen Zündeln, ohne Idee, wie ein „Flächenbrand einzuhegen“ wäre. „Weil die Empörung über die Ungerechtigkeit keinen Hebel findet, um die Welt besser zu machen, wandert sie zurück in die Seele des Empörten. Die Selbstvergiftung an der eigenen Empörung wird zum Ressentiment.“
Linke Identitätspolitik sieht Stegemann als „Kind postmoderner Theorien“, aber auch als eine „Form spätmoderner Machtpolitik“, die gemeinschaftlichen Widerstand eindämmen will. „Der Ausgangspunkt dieser Politik liegt passend zur Atomisierung der Gesellschaft in der Kränkungserfahrung des Einzelnen.“ Um der individuellen Wut einen Resonanzraum zu geben, bilden sich „Kränkungskollektive“, die ihrerseits zwischen „Opfer- und Tätergruppen“ unterscheiden. Dass oft weniger über konkrete Forderungen diskutiert wird als über die Frage, wer überhaupt berechtigt ist, Forderungen zu erheben, hat auch mit sozialen Netzwerken zu tun. Wenn das Ziel klassischer linker Politik darin besteht, „Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen“, um aus Opfern „gleichberechtigte Menschen“ zu machen, geht es hier um die Behauptung des Opferstatus an sich, weil dies die größte Aufmerksamkeit verspricht. Die Wut mutiert von einem Gefühl der Ohnmacht zu einem, „das dem Wütenden gefällt“, weil man sich selbst dadurch „gewisser“ und „wichtiger“ wird. Der Plan, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, tritt zurück hinter die „Lust“ an Empörung. „Die auftrumpfende Geste, besser als die Mitmenschen zu sein“, sie mag einem nicht gefallen, weil sie ausgrenzend wirkt. Doch ist sei ein Produkt dieser Ellenbogengesellschaft, die umfassende Gerechtigkeit in weite Ferne rückt.
Um eine „Balance zu finden zwischen einer gelähmten Gesellschaft und einer Welt in permanentem Aufruhr“ bringt Stegemann den Begriff „Wutkultur“ ins Spiel, der einen Zustand beschreibt, aber auch die Vorstellung von Kultivierung enthält. Derzeit sieht es wohl nicht so aus, als ob das gelingen könnte. Eine Verbindung der Einzelkämpfer? Das wäre wünschenswert, würde aber den Herrschaftsverhältnissen wirklich gefährlich und deshalb auf jede nur mögliche Weise verhindert werden.
Bernd Stegemann: Wutkultur. Verlag Theater der Zeit, 103 S., Leinen, 12 €.